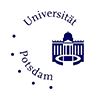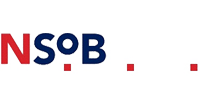Große Infrastrukturvorhaben und Wahlkämpfe stehen in Deutschland in einem ganz besonderen Verhältnis zueinander. Die Energiewende bringt es mit sich, dass es viele große Vorhaben bedarf, um die Herkulesaufgabe der Transformation des deutschen Energiesystems zu bewerkstelligen. Dies gilt insbesondere für den Stromnetzausbau, der die Voraussetzung ist, Erzeugungsengpässe überwinden zu können. Dafür wird der Strom vom Norden in den Süden transportiert. Der Bau der Stromtrassen ist jedoch mit nicht unerheblichen Eingriffen in das Landschaftsbild und somit auch in das Leben der Anwohner verbunden. Das politische Sprichwort „irgendwo ist immer eine Wahl“ verkompliziert jedoch den Planungs- und Bauprozess der dringend benötigten Trassen.
Noch bevor die heiße Wahlkampfphase im bayerischen Kommunalwahlkampf 2014 begonnen hatte, ließ Horst Seehofer (CSU), Bayerns Ministerpräsident, eine politische Bombe platzen. Er forderte am 4. Februar 2014 ein Moratorium des Netzausbaus. Bayern brauche keine Stromautobahnen, auch weil sich die rechtlichen Rahmenbedingungen der Förderung erneuerbarer Energien änderten und es zu erwarten war, dass weniger Ökostrom aus dem Norden abtransportiert werden würde. Der Leitungsausbau galt bis dahin als politischer Konsens – auch Bayern hatte für entsprechende Gesetze im Bundesrat gestimmt, weshalb die Reaktionen auf Seehofer sehr scharf ausfielen: es hagelte Kritik von allen Seiten. Doch welche planerischen Konsequenzen folgten diesem einseitigen Schritt der bayerischen Staatsregierung? Welche Folgen hatte diese Politisierung eines Implementationsprozesses? Die vorliegende Falldarstellung gibt nicht nur Antwort auf diese Fragen, sondern beleuchtet auch die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen sowie die Rolle der Übertragungsnetzbetreiber im Umsetzungsprozess der Energiewende und im Zusammenspiel mit dem Staat.
„Energiepolitischer Irrläufer“ oder begnadeter Wahlkämpfer?
Die politischen und planerischen Konsequenzen des geforderten Netzausbau-Moratoriums der bayerischen Staatsregierung.
„Seehofer ist ein energiepolitischer Irrläufer. Der muss dringend ins Abklingbecken.“[1] Diese wenig schmeichelhaften Worte fand Garrelt Duin (SPD), Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen (NRW), für den bayerischen Ministerpräsident. Dieser Aufreger ließ den politischen Blutdruck in der Bundesrepublik (mal wieder) steigen. Hinterher sollte Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Horst Seehofers (CSU) „eigenes Naturell“[2] als Erklärung bemühen – doch was löste diese politische Aufregung aus, was war geschehen? Seehofer wäre nicht Seehofer, wenn er nicht hin und wieder eine politische Bombe platzen ließe. So auch am 4. Februar, als er nach einer Kabinettssitzung zusammen mit Christine Haderthauer (CSU), seiner Chefin der Staatskanzlei, die Forderung nach einem Moratorium für Planungen von großen Stromautobahnen in Bayern artikulierte. „Es soll sich niemand einbilden, dass man gegen die Bevölkerung und den Freistaat Bayern so etwas machen kann.“[3] Außerdem seien bestehende Planungen zu überprüfen, um auf eine veränderte Geschäftsgrundlage durch die anstehende Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) zu reagieren.[4] Schließlich müsse geprüft werden, ob die Trassen überhaupt benötigt werden, wenn die Förderung erneuerbarer Energien in Zukunft reduziert wird und vor diesem Hintergrund von einem geringeren Ausbau von Ökostrom ausgegangen werden kann.
Vertreter anderer Bundesländer oder der Opposition in Bayern sowie im Bundestag waren wenig zurückhaltend mit Verurteilungen und äußerten massive Kritik an Seehofers Richtungsänderung. Ein Blick in den politischen Kalender zeigte in Bayern eine Kommunalwahl im März an. Schnell wurde ein Zusammenhang zu dieser Wahl, die am 16. März stattfand, hergestellt. Im Freistaat hatte sich massiver Widerstand gegen die „Monstertrassen“ Bahn gebrochen. Seehofer als populistischer Wahlkämpfer – das schien alt bekannt und ins Muster zu passen.[5] Die SPD Generalsekretärin Jasmin Fahimi wollte sogar ein – selbst für Seehofer – „bisher unerreichtes Niveau politischer Raserei“[6] erkennen.
Jedoch löste Seehofers Gebaren nicht nur in der politischen Arena Irritationen und Hektik aus. Der Februar und der März 2014 waren auch in der Tulpenstraße in Bonn eine turbulente Zeit. Wie hing die Aufregung in Bayern mit der in Bonn zusammen, was hatte der bayerische Kommunalwahlkampf mit der ehemaligen Bundeshauptstadt zu tun? In der Tulpenstraße steht der Hauptsitz der Bundesnetzagentur (BNetzA). Die obere Bundesbehörde ist nicht nur für die Regulierung des Wettbewerbs der Telekommunikation oder der Eisenbahn zuständig, sondern vielmehr für alle sogenannten Netzmärkte verantwortlich – so auch für den Sektor Elektrizität. Im Zuge der Energiewende hat die oberste deutsche Regulierungsbehörde wichtige Kompetenzen und Aufgaben beim Ausbau der Stromnetzinfrastruktur übertragen bekommen. Bislang ist das deutsche Stromnetz nicht ausreichend auf die verstärkte Einspeisung erneuerbarer Energien vorbereitet, denn in dem jetzigen Zustand sind die Netze nur bedingt in der Lage, große Mengen erneuerbaren Stroms über große Distanzen zu transportieren und zu verteilen. Weil die Erneuerbaren allerdings den Atomstrom bis 2022 restlos ersetzen und darüber hinaus einen immer größeren Anteil am Stromverbrauch decken sollen, steigt der Bedarf an Stromautobahnen.[7] Diese Stromautobahnen transportieren den Strom aus den Gebieten, in denen er produziert wird, in die Gegenden, in denen er verbraucht wird – dies bedeutet eine gängige Fließrichtung von Nord nach Süd. Für deren Planung ist die BNetzA zuständig, weshalb die Behörde zu einem zentralen Akteur der Energiewende geworden ist.
Die erste Reaktion der BNetzA auf Seehofers Verlautbarungen fiel verhalten aus – deren Präsident Jochen Homann wollte die Forderung nach einem Moratorium nicht kommentieren. Allerdings hatte er sich im Zuge der EEG-Reformdiskussion schon vorausschauend zu den planerischen Konsequenzen geäußert: „Nicht jede Veränderung der Ausbauszenarien führt auch zu einer Veränderung im Netzentwicklungsplan.“[8] Mitte März war dann die bayerische Kommunalwahl vorüber – die CSU rutschte mit 39,7 Prozent unter die 40 Prozentmarke[9] –, jedoch standen die Energiewende und der Stromtrassenausbau noch immer auf der politischen Agenda. Würde sich die Lage in Zukunft etwas beruhigen? Im Präsidiumsbüro von BNetzA Präsident Homann war jedenfalls wieder reges Treiben, intensiv wurde der für den 1. April angesetzte Energiegipfel im Kanzleramt vorbereitet. Neben dem Wirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel (SPD) und den Ministerpräsidenten der Länder sollte auch Jochen Homann teilnehmen. Auf der Tagesordnung stand nicht nur die Reform des EEG, sondern auch der zweite große Konfliktstoff, der eng mit dem ersten zusammenhängt: der Ausbau der Stromnetze.[10]
Rechtliche Rahmenbedingungen und bisheriger Planungsstand des Stromtrassenausbaus
In Deutschland regeln mehrere Gesetze den Energieleitungsausbau (weitere Informationen finden sich im Dossier). Im föderalen Geflecht der Bundesrepublik sind die Höchstspannungsleitungen, die vor allem durch das 2011 im Zuge der Energiewende verabschiedete Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG)[11] erfasst werden, besonders konfliktbehaftet. Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung hatte das Gesetz unter der Zielvorgabe beschlossen, länderübergreifende und grenzüberschreitende Trassenprojekte im Hinblick auf die Planungs- und Genehmigungszeit stark zu verkürzen. Weil an den bisherigen Genehmigungsverfahren mehrere Landesbehörden beteiligt waren, kam es zu Koordinationsproblemen und uneinheitlicher Rechtsanwendung; zudem waren die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger nur mangelhaft verankert, sodass es zu langwierigen Gerichtsprozessen kommen konnte. In der Konsequenz waren bislang Planungs- und Zulassungsverfahren mit einer Dauer von mehr als zehn Jahren eher die Regel als die Ausnahme – gebaut werden mussten die Trassen dann noch. Das NABEG sollte hier Abhilfe schaffen und das Genehmigungsverfahren auf vier bis fünf Jahre verkürzen. Zu diesem Zweck erhält die Bundesnetzagentur bei grenzüberschreitenden Vorhaben anstelle der Landesbehörden die Kompetenz für die Planfeststellungsverfahren. Außerdem wurden weitgehende Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger festgeschrieben – der Gesetzgeber hatte seine Lehren aus Stuttgart 21 gezogen. Jedoch steht es außer Frage, dass kürzere Verfahren und mehr Bürgerbeteiligung, wenn nicht im Widerspruch, so doch zumindest in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen.[12] Der Bau von neuen Trassenprojekten läuft dementsprechend in einem mehrstufigen Verfahren ab – auf jeder dieser Stufen ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. Auf der Grundlage eines eigens entwickelten Szenariorahmens fertigen die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) jährlich einen Netzentwicklungsplan an (NEP), den sie zur Genehmigung der BNetzA vorlegen. Diese fertigt zu den jeweiligen Vorhaben einen Umweltbericht an. Anschließend wird der NEP dem Gesetzgeber zugeleitet, der auf dieser Grundlage das Bundesbedarfsplangesetz beschließt. Der so beschlossene Bundesbedarfsplan weist den vordringlichen Bedarf für die nächsten zehn Jahre aus und legt somit die Projekte fest, die energiewirtschaftlich notwendig erscheinen. Wichtig ist zu betonen, dass der Plan nicht die exakte Trassenführung beinhaltet, sondern nur Start- und Endpunkte ausweist. Die Detailplanung wird von den Vorhabenträgern, sprich den ÜNB, vorgenommen und im Falle von grenzüberschreitenden Trassenverläufen von der BNetzA genehmigt, die für das Planfeststellungsverfahren zuständig ist (Eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens und Karten zu den Trassenplanungen finden sich im Dossier). Im Ergebnis bildet das erste Bundesbedarfsplangesetz 2013 einen Bedarf von 2800 Kilometern an kompletten Neubautrassen sowie 2900 Kilometern an Optimierungs- und Verstärkungsmaßnahmen ab. 36 Einzelvorhaben, wobei 16 davon länderübergreifende Qualität haben, werden dort ausgewiesen.
Hier nun entsteht das Problem für Bayern: Sechs der grenzüberschreitenden Vorhaben führen durch den Freistaat. Demzufolge wird nicht mehr über das „ob“ diskutiert, da Bundestag und Bundesrat darüber das letzte Wort im Gesetzgebungsprozess gesprochen haben. Im Bundesrat hat auch Bayern dem Bundesbedarfsplan zugestimmt. Im Falle Bayerns ist die energiewirtschaftliche Notwendigkeit neuer Trassen besonders augenscheinlich, da im Zuge der Energiewende und dem damit einhergehenden Atomausstieg bis 2022 massiv Erzeugungskapazitäten im Süden Deutschlands vom Netz gehen. Bayern ist aktuell noch zu ca. 50 Prozent von Atomstrom abhängig, bis 2022 muss dieser Anteil dementsprechend kompensiert werden – sonst drohen Gefahren für die Versorgungssicherheit.[13] Da es in anderen Teilen Deutschlands ein Kapazitätsüberhang gibt, kann Bayern Lücken durch Stromimporte decken. Der Präsident der BNetzA, Homann, wiederholt deshalb bei jeder Gelegenheit stoisch das Mantra: „Es gibt derzeit keinen Kapazitätsengpass, sondern einen Netzengpass.“[14] Seine Problemanalyse weist kein Erzeugungs-, sondern ein Verteilungsproblem aus. Aus diesem Grund sind im Bundesbedarfsplangesetz zwei Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-(HGÜ)Leitungen nach Bayern beschlossen worden, die Windstrom aus dem Norden und Solarstrom aus dem Osten in den Freistaat möglichst verlustarm transportieren sollen. Rechtzeitig zur endgültigen Abschaltung des letzten Atomkraftwerkes, sollen die HGÜ-Leitungen ab 2022 große Mengen Ökostrom von den lastfernen Erzeugungspunkten zu den Verbrauchszentren bringen. Die zentralen Projekte sind die 800 Kilometer lange „Sued.Link“ von Wilster in Schleswig-Holstein nach Grafenrheinfeld in Bayern[15], wo 2015 ein Atomkraftwerk abgeschaltet wird, und die 450 Kilometer lange sogenannte „Süd-Ost-Passage“[16], die von Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt durch Thüringen nach Meitingen bei Augsburg führt. Schon 2012 erklärte die Bundesnetzagentur zur Gleichstrompassage Süd-Ost:
„Aufgrund des absehbaren massiven Zubaus an Onshore-Windleistung sowie eines weiteren Ausbaus von Photovoltaikanlagen in Thüringen und Sachsen-Anhalt ergibt sich eine zusätzliche Überschussleistung aus den Regionen Thüringen und Sachsen-Anhalt.“[17] Weil ohne diese neue HGÜ-Leitung zunehmend Netzengpässe in allen drei betroffenen Bundesländern zu erwarten seien, ist diese Trasse ein Paradebeispiel für die notwendigen Infrastrukturanpassungen, die sich im Kontext der Energiewende ergeben.
Die beiden Vorhabenträger der Gleichstrompassage Süd-Ost, 50-Hertz für Sachsen-Anhalt und Amprion für Bayern, hatten ursprünglich vorgesehen, den Genehmigungsantrag im Rahmen der Bundesfachplanung, die nach NABEG mit einer Antragskonferenz zu beginnen hat, im ersten Quartal 2014 zu stellen. Doch dieser Zeitpunkt wurde schließlich durch die Moratoriumsforderungen nach hinten verschoben, sodass erst in der zweiten Jahreshälfte mit dem auf der dann stattfindenden Antragskonferenz vorgestellten Vorzugskorridor zu rechnen ist. Dennoch wurden erste Entwürfe zum möglichen Trassenverlauf veröffentlicht, sodass die Anwohner schon erahnen konnten, was da auf sie zukommen sollte – Angst vor Gesundheitsschäden und Immobilienwertverlusten kam auf.[18] Aufgrund des Zeitverzuges im Genehmigungsverfahren überschnitt sich die konkrete Trassenplanung mit der Erstellung des NEP 2014, der die nochmalige Infragestellung der Notwendigkeit einer Süd-Ost-Passage möglich machte. Anfang Februar 2014 wurde von TenneT und TransnetBW die von ihnen geplante Trassenführung für die HGÜ Sued.Link vorgestellt; hier befand sich die Planung also schon einen Schritt weiter.[19] Auch wenn das formale Genehmigungsverfahren noch nicht begonnen hatte, befanden sich beide Vorhaben allerdings bereits in der Phase der informalen verfahrensrechtlichen Bürgerbeteiligung.
Vom Widerstand vor Ort
Damit ist ein wesentlicher Knackpunkt des Leitungsausbaus benannt. Bürgerbeteiligung und das Abwägen öffentlicher Belange – was so nüchtern und sachlich klingt, kann sich in der Praxis schnell zu einem Sturm der Entrüstung entwickeln. Verwundern kann dies kaum, da dies nur Ausdruck von Zukunftsängsten der betroffenen Menschen vor Ort ist. Eines steht dabei außer Frage: Bayern hat vielfältige Erfahrungen mit dem Protest gegen den Trassenausbau. Schon im Jahr 2009 wurde im Energieleitungsausbaugesetz die Südwest-Kuppelleitung festgeschrieben, die sogenannte Thüringer Strombrücke. Sie führt von Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt quer durch Thüringen und den Thüringer Wald nach Redwitz in Bayern, wo sie durch ein weiteres Teilstück nach Grafenrheinfeld ergänzt wird. Weil dort 2015 ein Atomkraftwerk vom Netz geht, drängt die Zeit – die abzuschaltenden Kapazitäten sollen durch Stromimporte kompensiert werden, weshalb Ende 2015 die Thüringer Strombrücke komplett fertiggestellt sein soll. Da allerdings bislang nur Teilabschnitte realisiert sind und sich die Verbindung nach Bayern noch im Planfeststellungsverfahren befindet, kann es zu weiteren Verzögerungen kommen.[20] Die Gemeinde Großbreitenbach in Thüringen, an der die 380 kV-Drehstromleitung vorbeiführen wird, hatte gemeinsam mit einer Waldgenossenschaft und privaten Grundstückseigentümern vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die Trasse geklagt. Vergebens; 2013 erging das abschließende Urteil. Auch ein Eilantrag gegen die beginnenden Bauarbeiten wurde zuvor abgewiesen. Zum einen seien die Belange der Gemeinde ausreichend berücksichtigt worden – dadurch dass die Trasse an der Autobahn und ICE-Strecke entlang führt, ist der Eingriff in die Landschaft deutlich verringert worden –, zum anderen habe das Projekt als nationale Kuppelleitung eine tragende Funktion.[21] In Bayern lässt man sich von solchen Gerichtsentscheidungen nicht entmutigen. Auch hier gibt es seit Jahren hohen Widerstand gegen die Thüringer Strombrücke, so hat sich beispielsweise im Raum Coburg die Bürgerinitiative „Achtung Hochspannung“ gegründet, die Demonstrationen und Mahnwachen veranstaltet. Nicht nur, dass 45 Hektar Wald dem Leitungsvorhaben zum Opfer fallen sollen, die Menschen vor Ort machen sich Sorgen um gesundheitliche Risiken, wie z.B. ein erhöhtes Krebsrisiko. Vor allem fühlen sie sich aber aufgrund der Mehrfachbelastung überbeansprucht – schließlich führen die Autobahn A 73, eine ICE-Neubaustrecke und eine 110 kV-Leitung durch das Coburger Land im westlichen Oberfranken. Das Raum-Ordnungs-Gesetz sieht solche Trassenbündelungen von Linienbauten vor, um den Eingriff in die Landschaft zu minimieren.[22] So einleuchtend das Prinzip ist, die Anwohner fühlen sich förmlich erdrückt. Die Bürgerbeteiligung verursachte Unmut, da das Vorhaben noch nach dem alten Genehmigungsverfahren und nicht nach dem neuen NABEG-Verfahren vollzogen wird.
Süd-Ost-Passage: Bayern empört sich
Was für die Thüringer Strombrücke gilt, gilt erst recht für die Süd-Ost-Passage – die Angst vor der „Monstertrasse“ geht in Oberfranken um.[23] So wie der Stand der Planungen ist, bleibt Coburg diesmal verschont. Der Vorzugskorridor der 450 Kilometer langen Trasse verläuft entlang der A 9 durch das östliche Oberfranken, vorbei an den Städten Hof, Wunsiedel und Bayreuth. CSU Bundestagsabgeordneter Hans Michelbach begrüßt diese Planungsentscheidung. Die Lasten der Energiewende müssten gerecht verteilt werden, es könne nicht sein, diese nur einer einzigen oberfränkischen Region aufbürden zu wollen.[24] Das mit der Solidarität ist aber so eine Sache. Ob man es nun Sankt-Florian-Prinzip oder NIMBY („Not in my backyard“) nennen möchte, der Zuspruch zu den für die Energiewende notwendigen Stromleitungen endet meist dann, wenn ein Betroffenheitsverhältnis entsteht. Der Landrat Bernd Hering lehnt die HGÜ-Leitung durch den Kreis Hof nicht nur ab, sondern äußert auch wenig Verständnis dafür, dass der Trassenverlauf an Coburg vorbei fallengelassen wurde. „Die Trasse weiter westlich wäre der direkte Weg gewesen.“[25]
Entlang der potentiellen Trassenrouten haben sich zahlreiche Bürgerinitiativen gegen das Trassenvorhaben gegründet. Sie haben die mal weniger klangvollen Namen wie Bürgerinitiative „Gemeinde Leinburg gegen die Stromtrasse Süd-Ost“, mal mit einem Hang zur Dramatik: „Trassenwahn 17.01“ – so lautet der Planungsabschnitt, der an der Gemeinde Berg in der Oberpfalz vorbeiläuft. Auf der Internetseite des Aktionsbündnisses prangt ein Totenkopf in den ein Hochspannungspfeil-Blitz einschlägt. Ihnen gemeinsam ist das Gefühl der Ohnmacht und der Zorn auf die Politik. Eine Bürgerin äußert gegenüber der Presse: „Ich könnte wirklich platzen vor Wut, wie da mit uns umgegangen wird.“ Gegen die Energiewende sind die ‚Wutbürger‘ aber ausdrücklich nicht, sie soll nur richtig gemacht werden – vor allem von der Notwendigkeit der Trasse sind sie nicht überzeugt. „Das ist ja die größte Sauerei, dass die mit dieser Trasse den Strom aus den Braunkohlekraftwerken transportieren wollen, den größten Drecksschleudern, die es gibt.“[26] Sowohl Gegner als auch Befürworter argumentieren also mit der Energiewende. Zudem mischen sich aber auch ganz pragmatische Sorgen in die Kritik an dem Ausbauvorhaben. Herbert Himmler, Bürgermeister der Gemeinde Berg, meint dazu: „Das ist ganz klar, dass diese [betroffenen] Dörfer keinerlei Entwicklungsmöglichkeiten mehr haben. Da können sie schon jetzt keine Immobilie mehr verkaufen. Das haut mit aller Wucht in die Lebensplanung der Leute rein, die dort wohnen.“[27]
Fallende Immobilienpreise sind keine seltene Angst von Anwohnern, da Deutschland ein dicht besiedeltes Land ist, gelingt es den ÜNB auch nicht immer, den Mindestabstand einzuhalten. Planungen sehen vor, dass die Trassen über einzelne Bauernhöfe direkt hinweg gehen. Zu der optischen Wirkung und dem Eingriff in das Landschaftsbild kommt dann noch die Zerstörung der Natur – Verschandelung sei dabei nur ein Euphemismus für den Bau solcher Trassen, sagen die Trassengegner. Nicht zu vergessen die Furcht vor Gesundheitsschäden.[28] Das Bundesamt für Strahlenschutz verweist zwar auf die einzuhaltenden Grenzwerte,[29] denn zweifelsfrei baut sich ein magnetisches Feld auf. Die Wissenschaft konnte die gesundheitlichen Wirkungen nicht abschließend klären, die Grenzwerte sollen aber jeglichem Gesundheitsrisiko vorbeugen. Dies überzeugt jedoch nicht alle Anwohner restlos. Vor allem, da in Deutschland bislang keine Erfahrungen mit HGÜ-Leitungen vorliegen. Kritiker verweisen darauf, dass bislang in den Wüsten Namibias oder den Prärien Kanadas solche Ungetüme stehen würden, also in menschenleeren Gegenenden. Die Maße der HGÜ-Trasse lesen sich dementsprechend beeindruckend: 75 Meter hohe Masten und 40 Meter breite Querträger bei Gleichstrom, der mit einer Spannung von bis zu einer Million Volt fließt.[30] Eine weitere Forderung ist, in der Nähe von Ortschaften anstatt Freileitungen den Weg über Erdverkabelung zu wählen. Jedoch muss dazu festgehalten werden, dass Erdkabel nicht nur wesentlich teurer sind – je nach Gegebenheiten können die Kosten sich verdreifachen. Sie bedeuten auch einen deutlich höheren Eingriff in die Natur und sind zudem rechtlich im Projekt nicht vorgesehen. Im Bundesbedarfsplangesetz hätte die Süd-Ost-Passage mit einem entsprechenden Pilotprojektstatus, da die Technik noch nicht ausgereift ist, gekennzeichnet sein müssen − was aber nicht der Fall ist.
Für die Bürger blieb Bürgerbeteiligung Theorie, vielmehr fühlen sich die Bürger von den Plänen der ÜNB überfahren. Man wusste von nichts, bis man aus der Lokalzeitung las, dass die Trasse kommt – sie sei schon beschlossene Sache. Trotz aller Verfahrensfortschritte des NABEG, trotz der Möglichkeit, sich in der Frühphase zu beteiligen, trotz dieses in der Theorie hochgelobten Gesetzes, ist es in der Praxis seine akzeptanzschaffende und konfliktverhütende Wirkung schuldig geblieben. Dabei handelt es sich um ein strukturelles Problem, denn es wird zwar immer mehr Transparenz hergestellt, indem Planungsunterlagen im Internet veröffentlicht werden – allerdings liegen die Aufmerksamkeitsschwellen dafür scheinbar zu hoch.[31] Plakativ gesagt, liest der Normalbürger eben nicht das Bundesgesetzblatt. Seit 2011 waren die Planungen für diese Trasse öffentlich bekannt, doch der Widerstand baute sich erst auf, als das Genehmigungsverfahren in einem fortgeschrittenen Stadium war. Ein Faktor ist sicherlich auch, dass die Planungen in den Frühphasen, wo die Einflussmöglichkeiten noch am größten sind, zu unkonkret sind und sich deshalb keine direkte Betroffenheit erkennen lässt. Im Oktober 2013 berichteten bayerische Zeitungen von den ersten Grobplanungen durch Amprion. Obwohl die betroffenen Regionen schon zu identifizieren waren,[32] schlugen diese Nachrichten nur verhältnismäßig kleine Wellen. Mitte Januar 2014 stellte Amprion erste Trassenkorridore vor. Während viele Bürgermeister noch über die Informationspolitik des ÜNB erzürnt waren und das unzureichende Kartenmaterial kritisierten,[33] ging alles ganz schnell. Das Mobilisierungspotenzial war gewaltig, als den Menschen klar wurde, was ihnen da drohte. Der Protest gegen die Süd-Ost-Passage verbreitete sich dementsprechend wie ein Lauffeuer, zu Tausenden machten die Bürger ihrem Ärger Luft. Ob auf dem Dorf oder in der Stadt – es mussten extra Hallen angemietet werden, um dem Ansturm an Interessierten gerecht zu werden. Da wurde so manche Informationsveranstaltung oder ein Erörterungstermin für die Moderatoren der ÜNB zum Spießrutenlauf. Solche Veranstaltungen wurden zum high noon zwischen den Kontrahenten,[34] von einem dialogischen Verfahren konnte keine Rede mehr sein, weil schon akustisch gar keine Verständigung mehr möglich war. Teilnehmer berichten von einer Versammlung Ende Januar 2014 in Nürnberg, es sei ein Höllenspektakel gewesen. Irgendwann haben die Leute „Wir sind das Volk“ skandiert, der Lärm der Trillerpfeifen sei kaum zu ertragen gewesen. Ein CSU-Bürgermeister, der mit dabei war, sieht das Ganze etwas differenzierter: „Das war schon grenzwertig in Nürnberg, aber im Nachhinein sage ich: Wenn es nicht diesen massiven Protest gegeben hätte, wären die Medien nicht auf uns aufmerksam geworden.“[35] Es sollte nicht bei den Medien bleiben.
Kommunalwahl: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte
Die Kommunalpolitik ist der natürliche Resonanzboden für solch einen breiten Bürgerprotest. Dabei ist diese Ebene eine besonders sensible Stellschraube für die Energiewende, deren Erfolg bedarf der Vermittlung durch die Kommunalpolitik, weil gerade diese vor Ort für Akzeptanz sorgen kann.[36]Demgegenüber ist die Kommunalpolitik aber auch gewissen Versuchungen ausgesetzt. Auch im Fall der Süd-Ost-Passage musste nicht lange darauf gewartet werden, bis die Kommunalpolitiker sich hinter den Protestlern versammelten und den Unmut in den Parteien nach oben trugen. Bei einem Zusammentreffen Horst Seehofers mit den CSU-Landräten und Landratskandidaten für die bayerische Kommunalwahl im März 2014 beschwerten sich diese über das kommunikative Gebaren von Amprion, der ÜNB sei einseitig vorgeprescht. So mancher Mandatsträger fürchtete wohl schon in der nahenden Kommunalwahl sein Amt zu verlieren. Der bayerische Ministerpräsident erklärte daraufhin, dass es solche Leitungen nur zusammen mit den Regionen und den Bürgern geben könne. Jakob Kreidl (CSU), Chef des Bayerischen Landkreistages, äußerte nach dem Treffen: „Der Ministerpräsident hat uns gesagt, solche Planungen kann man nicht über die Köpfe der Menschen hinweg machen.“[37] Der mediale Paukenschlag blieb aber noch aus. Bis zum 4. Februar.
Nach einer Kabinettssitzung der Bayerischen Staatsregierung verkündet Seehofer zusammen mit Christine Haderthauer die Forderung nach einem Moratorium für den Stromnetzausbau. Dass Seehofer nur forderte, war dabei keineswegs nur eine semantische Feinheit – der Freistaat Bayern hat nicht die Kompetenz, ein solches Moratorium zu verkünden. Einerseits begründeten die beiden diesen Schritt offiziell mit der veränderten Geschäftsgrundlage, die sich aus der angestrebten EEG-Reform ergebe. Denn eine reduzierte Förderung der Erneuerbaren führe auch zu einem reduzierten Ausbau, so jedenfalls das Kalkül. Dann bräuchte man auch nicht mehr die Stromtrassen nach Bayern – Seehofer argumentierte vor allem gegen die Süd-Ost-Passage. „Die Netzbetreiber haben ihre Planungen zunächst einmal zu unterbrechen“, sagte Haderthauer.[38] Damit waren auch Vorwürfe an Amprion verbunden, die Staatskanzlei nicht ausreichend in den Prozess eingebunden zu haben. Der Geschäftsführer vom Amprion, Klaus Kleinekorte, verteidigte das Vorgehen: „Unsere Planungen finden auf Grundlage des von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Bundesbedarfsplangesetzes statt. Dabei ist Transparenz und Bürgerdialog für uns ganz wichtig, gerade auch in der Zeit vor den offiziellen Genehmigungsverfahren.“[39] Inoffiziell dürfte andererseits Seehofer auf der Seite der Bürger stehen wollen, das ist sein Regierungsstil – so war es beim Donauausbau, bei Windrädern und Pumpspeicherkraftwerken sowie bei den Studiengebühren. Vor Wahlen wurden noch schnell politisch brisante Themen abgeräumt.[40] Dabei kümmerte es Seehofer wohl nicht allzu sehr, dass Bayern im Bundesrat der Gleichstrompassage Süd-Ost mit dem Bundesbedarfsplangesetz ein paar Monate zuvor zugestimmt hatte. Politisch stand im Fokus, die für CSU-Verhältnisse verheerende Wahlschlappe aus der Kommunalwahl 2008 wieder wett zu machen. Damals erreichte die CSU nur 40 Prozent, ein bis dato unvorstellbares Ergebnis, nachdem unter Stoiber im Land sogar eine Zweidrittelmehrheit möglich wurde. Das schlechte Wahlergebnis wurde dann auch als Kollateralschaden des Sturzes Stoibers interpretiert, einem nur temporären Ereignis geschuldet, die besseren Tage wieder im Blick. Die vormals alte Stärke der CSU gründete sich in ihrer festen Verwurzelung und Dominanz in den Gemeinden. Seehofers Richtungswechsel in Sachen Stromnetzausbau konnte als Indiz interpretiert werden, dass er an diese Zeiten anknüpfen wollte.[41] Das CSU-Wahlergebnis ließ jedoch einen anderen Schluss zu. Nicht nur, dass bei der Kommunalwahl am Ende nicht einmal mehr eine vier vor dem Komma stand, sondern da, wo er auf Stimmenfang gehen wollte – in den Protestkommunen – verspottete man den Ministerpräsident als „Drehhofer“. Dort war nicht vergessen, dass Seehofer seine Hand für die Bundesbedarfsplanung im Bundesrat gehoben hatte.[42]
Die politischen Reaktionen – von Irritationen bis zum Gegenangriff
Die ÜNB reagierten irritiert auf Seehofers Ankündigung. TenneT kündigte an, die geplanten Bürgerinformationen zu Sued.Link aufzuschieben. „Wir können keinen Dialog mit den Bürgern führen, wenn die Grundsatzfrage von der Politik neu aufgeworfen wird“, sagte TenneT-Geschäftsführer Lex Hartmann. „Akzeptanz muss zuerst von der Politik kommen, nicht nur juristisch und formell, sondern auch inhaltlich. Sonst kann man die Diskussion nicht führen.“[43] Auch Amprion und 50Hertz kündigten an, sich Zeit zu lassen, bis man wisse, woran man sei. Resultat: Mindestens ein Vierteljahr Verzögerung der Planungen.[44]
Die politischen Reaktionen auf die Moratoriumsforderung waren entschieden und zum Teil heftig, Seehofers Rütteln am Energiewendekonsens hat ein politisches Erdbeben ausgelöst: Der EU-Energiekommissar haderte, das eigene Lager murrte, die Wirtschaft war entsetzt, der politische Gegner schimpfte und sogar die Kanzlerin mahnte. Seehofer erläuterte am 5. Februar seinen Kurswechsel in Sachen Energiewende im bayerischen Landtag – in seiner Rede bekannte er sich zwar zum beschleunigten Bau der Thüringer Strombrücke:
„Auch hier will ich Klarheit schaffen, weil alles durcheinandergebracht wird. Seit 2009 gibt es eine Diskussion und Verfahren zur Strombrücke Thüringen-Grafenrheinfeld, die über Oberfranken führt. Diese Wechselstrombrücke ist völlig unabhängig von der Energiewende für die Stromstabilisierung notwendig. […]Deshalb sage ich auch hier und bitte dabei um die notwendige Differenzierung: Diese Wechselstrombrücke über Thüringen und Oberfranken nach Grafenrheinfeld wird von uns unterstützt.“ [45]
Hingegen müssten die HGÜ-Leitungen jedoch geprüft werden.[46] Währenddessen schossen sich weitere Ministerpräsidenten und Minister auf Seehofer ein. Thorsten Albig (SPD), Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, sah in der Energiewende ein Jahrhundertprojekt, bei dem man sich nicht in Opportunismus verlieren dürfe. Wenn die Politik jedes Mal vor einer Wahl einknicke, könne man die Energiewende vergessen, denn irgendwo sei immer eine Wahl. „Wir müssen den Menschen doch ehrlich und mit Arsch in der Hose sagen, dass der Ausstieg aus der Atomenergie auch Folgen hat. Auch Folgen, die wir alle persönlich nicht mögen.“[47] Sein Energieminister, der Grüne Robert Habeck, spitze etwas schärfer zu: „Wenn die letzten AKW abgeschaltet werden, muss genug erneuerbarer Strom auch in Bayern sein. Wenn man jetzt den Netzausbau insgesamt attackiert, dann kündigt man doch in Wahrheit den Atomausstieg auf.“[48] Seehofer in die fast schon verbotene politische Ecke der deutschen Spitzenpolitik „Ausstieg aus dem Konsens zum Atomausstieg“ zu stellen, war schon eine ganz große Keule – und Habeck nicht der einzige, der sie schwang. NRW-Wirtschaftsminister Duin blies ins selbe Horn: „Ohne die nötigen Netze werden irgendwann 2018 oder 2019 die Stimmen lauter werden, Atomkraftwerke in Süddeutschland länger laufen zu lassen. Das möchte ich nicht.“[49]
Solche Äußerungen waren nicht alleine dem Parteienwettbewerb geschuldet, sondern spiegelten auch die Interessenlagen der Länder wider. Insbesondere die norddeutschen Länder fielen durch harsche Kritik an Seehofers Position auf. Christian Pegel (SPD), Energieminister in Mecklenburg-Vorpommern, sprach sehr offen über die Motivation für seine Äußerungen. „Die großen Unternehmen, die ihm [Seehofer] in Bayern mit ihren Steuern die Landeskasse füllen, brauchen künftig auch Windstrom aus dem Norden.“ Bei der anstehenden Reform des EEG gehe es um ein Gesamtpaket, bei dem die Interessen einzelner Bundesländer und des Bundes in Einklang gebracht werden müssten. Ebenso wie Schleswig-Holstein will Mecklenburg-Vorpommern schon in wenigen Jahren den eigenen Energiebedarf mit Ökostrom decken, zudem sollen die Erneuerbaren zum Exportschlager in andere Bundesländer werden.[50] Der auch öffentlich hergestellte Zusammenhang zur EEG-Reform ist ein starkes Indiz dafür, dass der Ausbauboykott Teil einer Verhandlungsstrategie Bayerns im Wettrennen mit den anderen Ländern um die Fördermilliarden des EEG war; denn fehlende Leitungen treffen vor allem die Windstromproduzenten im Norden. In den Reformplänen von Sigmar Gabriel wird beispielsweise die für Bayern so wichtige Bioenergie stark beschnitten. Es drängte sich der Eindruck auf, dass Seehofer den Stromnetzausbau als Faustpfand einsetzte. Darüber hinaus hatte Bayern zusammen mit Baden-Württemberg die Bundesregierung bis Mitte des Jahres aufgefordert, ein Konzept für die regionale Kraftwerksförderung aufzustellen, was eigenen energiewirtschaftlichen Autarkievorstellungen Bayerns entgegenkommen würde.[51] Auch dafür konnte der Netzausbau Druckmittel sein.
Es waren aber nicht nur die Länder, die ihrer Empörung Ausdruck verliehen – auch EU Energiekommissar Günther Oettinger (CDU) rief Seehofer zur Ordnung. „Die Leitungen sind notwendig ̶ und zwar sehr schnell.“ In Bayern gingen „in den nächsten Jahren große Kernkraftwerke vom Netz.“ Er rief den bayerischen Ministerpräsidenten zum Einlenken auf, betonte aber gleichzeitig die Bedeutung der Bürgerbeteiligung. „Wenn er den Bau der Stromtrassen ermöglicht und mitwirkt, dass die Akzeptanz steigt, ist das sehr willkommen.“ Es sei deshalb wichtig, die Bürger einzubinden. Man müsse mit ihnen sprechen, „welcher Trassenverlauf der umweltverträglichste ist ̶ links oder rechts ums Dorf herum.“[52] Seehofer wäre aber nicht Seehofer, wenn er nicht die passenden Worte dazu parat hätte. „Wir Bayern brauchen keine Belehrung von irgendjemand. Das Geschwätz, das dazu eingesetzt hat von EU-Kommissar Oettinger und anderen Ortsunkundigen, wird an dieser bayerischen Forderung nichts ändern.“ Vielmehr müsse allen Akteuren klar sein, dass „gegen den Willen des Freistaates Bayern und 200 Bürgermeistern und Landräten die Stromtrasse nicht kommen [kann].“[53] Außerdem wolle er die Energiewende nicht behindern, vielmehr sei Bayern das „Musterland bei der Umsetzung der Energiewende.“[54]
Der Konflikt um das Netzausbau-Moratorium spaltete die Bundesländer nicht nur in der föderalen Dimension, sondern trug auch Streit in die große Koalition. Die SPD reagierte mit großem Unverständnis auf den Versuch der CSU, den Koalitionsvertrag umzudeuten. Dort heißt es: „Netzausbau und Ausbau der erneuerbaren bedingen einander. Damit beides synchron läuft, sollte der Netzausbau zukünftig auf Basis des gesetzlich geregelten Ausbaupfads für erneuerbare Energien erfolgen.“[55] Seehofer hatte diese Passage auf die ihm eigne Art und Weise interpretiert. Ralf Stegner, SPD-Parteivizevorsitzender, forderte ein Machtwort von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). So wie in früheren Fällen auch, gehe er davon aus, dass Merkel Seehofer zur Ordnung rufen würde. Nur die bayerische Kommunalwahl im Blick, warf er Seehofer vor, das Thema für Wahlkampfzwecken zu missbrauchen. CSU Generalsekretär Andreas Scheuer wies diese Kritik hingegen zurück und verlangte, die Angriffe auf seinen Parteivorsitzenden sofort einzustellen. Anderenfalls würde sich dies zu einer dauerhaften Belastung in der großen Koalition auswachsen.[56] Folgerichtig ließ die Kanzlerin den Streit nicht lange laufen. Am 8. Februar positionierte sie sich eindeutig gegen die Forderung nach einem Moratorium. Ein solches Moratorium sei sicher „keine Antwort“ auf die fehlende Akzeptanz gegenüber neuen Stromtrassen. „Wir können nicht erst 2018 anfangen, den Plan für die HGÜs zu besprechen.“ Ausdrücklich wandte sie sich auch gegen die Forderung Seehofers, die Kernpunkte der Energiewende neu zu verhandeln. Dieser hatte angeführt, dass bei Stromtrassen nicht das Prinzip „einmal beschlossen, immer beschlossen“ Geltung beanspruchen könne. Die Kanzlerin sah zwar nicht alles in Stein gemeißelt, hielt aber doch an den HGÜ-Leitungen fest. „Wir müssen damit rechnen, dass wir von Jahr zu Jahr Planungen immer wieder ein Stück ändern werden“, aber große neue Stromtrassen seien davon nicht betroffen.[57] Uwe Beckmeyer (SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im Umweltministerium, sah das ähnlich und kam auch ohne Angriffe auf Seehofer aus, nüchtern stellte er fest: „Wir müssen Einzelinteressen ein bisschen zurückdrängen. Das gilt auch für die Einzelinteressen von Ländern. […] Ein Moratorium hat rechtlich keine Wirkung, es ist eine reine politische Willensbekundung.“ Es gebe ein Gesetz zum Leitungsausbau, dem auch Bayern zugestimmt habe. „Dieses Gesetz gilt.“[58] Peter Altmaier (CDU), Chef des Kanzleramtes, lud am 12. Februar zu einem Krisengespräch, um die verhärteten Fronten zwischen Bayern und Amprion etwas zu lockern und in dem Netzausbaustreit zu vermitteln. Mit Dabei waren zudem Vertreter Sachsen-Anhalts und Thüringens, die ebenfalls von der Süd-Ost-Passage betroffen sind. Den Durchbruch bedeutete das Treffen jedoch noch nicht.[59]
Darüber hinaus war keinesfalls Ruhe in der Netzausbau-Frage eingekehrt. Während Hans-Peter Friedrich (CSU), Bundeslandwirtschaftsminister, noch anregte, Erdkabel dort einzusetzen, „wo Bevölkerung und Landschaftsbild besonders beeinträchtigt werden“[60] und damit einen Kompromiss durch die Hintertür in die Diskussion einführte, versuchte Erwin Huber (CSU), Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im bayerischen Landtag, Deutungshoheit für den Wirtschaftsflügel der CSU zurückzugewinnen. Zum einen hätte Seehofer die Notwendigkeit für neue Trassen gar nicht in Frage gestellt – die ganze Aufregung sei folglich künstlich überzogen ̶, zum anderen habe Seehofer sich nur gegen einen überfallsartigen Bau neuer Leitungen gewandt. Es gebe keine neuen Linien in der Energiewende.[61] Die parteiinterne Diskussion in der CSU wurde noch einmal richtig angeheizt als eine Stellungnahme des bayerischen Umweltministeriums zum Bundesbedarfsplan 2013 bekannt wurde, in dem sogar noch weit größere Trassenkapazitäten gefordert wurden als vorgesehen waren. Der bayerische Importbedarf an Strom sei schlicht zu groß, insbesondere würden mehr Trassen nach Mitteldeutschland benötigt. Obendrein ließen sich Stimmen aus Ilse Aigners (CSU) Umfeld vernehmen, die Amprion stets einen umfassenden Einbezug der Bürger und Politiker bescheinigten – in diesen Kreisen gab man sich nicht damit zufrieden, dass die Staatskanzlei dem Wirtschaftsministerium mehr oder weniger die Kompetenz für die bayerische Energiepolitik entzogen hatte.[62]
Seehofer ließ sich durch dieses Störfeuer nicht beirren, er blieb in der Sache hart. Auch vor Ort besuchte er Demonstrationen, wie z.B. in Neuburg-Bergen. Dort unterstrich er, dass es „keine Schande“ sei, Politik für die Bevölkerung zu machen. Er halte die Trasse von Sachsen-Anhalt nach Bayern persönlich nicht für notwendig und sah kaum noch Realisierungschancen dafür. Auch ermunterte er die Bürgerinitiative weiter zu kämpfen. „An ihnen vorbei sind solche Sachen nicht zu machen.“[63]
Aber noch einmal zurück zu den Ländern: Neben der Diskussion um und den Zusammenhang mit der EEG-Reform gab es noch einen zweiten Strang des Konfliktes. Dabei ging es darum, einer Entsolidarisierung beim Netzausbau entgegenzuwirken. Von diesem sind prinzipiell alle Länder betroffen. Wenn die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) von einem falschen Signal Seehofers Sprach, wenn Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin in NRW, Seehofer verurteilte und der Umweltminister in Baden-Württemberg, Franz Untersteller (Grüne), feststellte, „es ist gefährlich, jetzt an jeder möglichen Ecke Beschlüsse in Frage zu stellen“[64], dann war das vor allem Ausdruck von einer Diffusions-Sorge. Bürgerproteste gibt es schließlich nicht nur in Bayern und wer will schon voraussagen, welche Dynamik sich im weiteren Netzausbau entfalten könnte. Dem scheinbar Alternativlosem auch weiterhin keine Alternative zu bieten, war somit auch eine Art Selbstschutz. Dass die Sorge nicht ganz unbegründet war, zeigte sich vor allem an der Reaktion aus Erfurt. Die thüringische Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) schlug sich auf die Seite Seehofers. Auch sie sah keine zwingende Notwendigkeit für die Süd-Ost-Passage – jedenfalls wenn diese durch Thüringen führen sollte. Thüringen habe bereits den Soll erfüllt, mit der Thüringer Strombrücke sei die Schmerzgrenze für das Land erreicht. Weitere Trassen durch den Thüringer Wald werde es unter keinen Umständen geben.[65] Im September 2014 findet in Thüringen übrigens eine Landtagswahl statt.
Vor dem Energiegipfel – das Dilemma der BNetzA
Die bayerische Kommunalwahl war passé, der Energiegipfel im Kanzleramt nahte. Im Präsidiumsbüro von Homann war man nicht untätig, denn das Dilemma breitete sich vor den Referenten aus wie ein großer Scherbenhaufen – schließlich galt es, den gordischen Knoten des Netzausbaus zu durschlagen. Wie konnte es gelingen, einerseits eine Verfahrensbeschleunigung zu erreichen und gleichzeitig den politischen Zielen und sachlogischen Notwendigkeiten der Energiewende gerecht zu werden, sowie andererseits eine Akzeptanzsteigerung in der Bevölkerung herbeizuführen? Hatte das NABEG bei seiner ersten großen Generalprobe gleich versagt? Führen die frühen Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten nur dazu, falsche Hoffnungen aufzubauen, weil die Trasse am Ende doch nicht von den Bürgern verhindert werden kann? Sind die Pläne zu Verfahrensbeginn nicht zu abstrakt, um überhaupt von den Anwohnern wahrgenommen zu werden?
Zweifelsfrei existiert ein Spannungsverhältnis um die Verfahrensbeschleunigung, denn sie ist nicht nur erklärtes Ziel der Politik, sondern auch durch neue Beteiligungsmöglichkeiten so angestrebt. Ob aber gerade diese in der Praxis nicht zu einer Entschleunigung führen, bleibt zu diskutieren. Dabei ist es jedoch unabdingbar, auch die Grenzen der Planungsverfahren zu beachten. Der Zielkonflikt im Verfahrensrecht konnte auch im NABEG nicht aufgelöst werden: In erster Linie handelt es sich nämlich dort um den vorgezogenen Rechtsschutz der betroffenen Bürger; Projektentwürfe dialogisch mit den Bürgern zu gestalten ist vielmehr nur sekundär. „Den Aushandlungsprozessen zwischen den beteiligten Bürgern, dem Vorhabenträger und den zuständigen Behörden sind Grenzen gesetzt, weil auch das demokratische Beteiligungsverfahren eben nicht ohne Weiteres in die Grundrechte der Betroffenen eingreifen darf.“[66]
Welche Vorgehensweise der BNetzA kann gewählt werden? Zweifelsohne hat Bayern nicht die rechtliche Kompetenz, einen Planungsstopp über den Netzausbau zu verhängen. Doch ist es ratsam, in einer Güterabwägung dem BNetzA Präsidenten Homann zu empfehlen, auf eine strikte Durchsetzung des Trassenausbaus zu pochen? Liegt dies im tatsächlichen Interesse der Verfahrensbeschleunigung und welche Auswirkungen hat dies auf das politische Klima der Energiewende? Etwas spezieller gefragt: Können in Wahlkampfzeiten überhaupt unliebsame Infrastrukturprojekte umgesetzt werden und welchen Weg kann man beschreiten, um dies zu ermöglichen? Ist es nicht vielmehr richtig, Gestaltungsfragen des Netzausbaus zu politisieren? Welchen Apell soll Homann an die Politik richten? Was man in dem Fall der Süd-Ost-Passage beobachten kann, ist vor allem ein kommunikatives Desaster, eine Kakophonie, die den unterschiedlichen politischen Interessen geschuldet ist. Wie lässt sich das in Zukunft verhindern?
Das Bundesbedarfsplangesetz ist nicht einmal ein Jahr alt und schon wird wild über dessen Inhalt diskutiert. Das Extrem, dass Trassen nicht gebaut werden, ist sicherlich kaum denkbar – doch welche Kompromissmöglichkeiten bieten sich an? Das laufende Verfahren um den Netzentwicklungsplan 2014 bietet möglicherweise Gelegenheit, die Möglichkeit der Erdverkabelung nachträglich für Trassenabschnitte auszuweisen. In einem neuen politischen Prozess könnte eventuell das Bundesbedarfsplangesetz in dieser Hinsicht aktualisiert werden. Sind die so erwartbaren Verzögerungen zu verschmerzen oder sollte man die Proteste besser einfach aussitzen?
Die BNetzA ist nicht nur die oberste Regulierungsbehörde, sondern in der Energiewende auch zu einem politischen Spieler geworden. Es galt die vielen Fragen zu erörtern und kluge Empfehlungen vorzubereiten. Keine leichte Aufgabe.
Teil II: Dossier
Ein zentraler Pfeiler der Energiewende: der Netzausbau
Ob die Energiewende nun mit dem Ausstieg aus der Atomenergie oder der Transformation des gesamten Energieversorgungssystems beschrieben wird, dem Netzausbau kommt dabei eine tragende Rolle zu. Mit der Entscheidung zu der beschleunigten Energiewende der schwarz-gelben Bundesregierung im Jahr 2011 stand fest, dass die erneuerbaren Technologien stark ausgebaut werden müssen, damit sie in Zukunft einen größeren Anteil an der Stromproduktion decken können. Dies stellt aus zwei Gründen jedoch gleichzeitig eine Herausforderung für die Versorgungssicherheit dar: erstens sind die erneuerbaren Quellen, die sich im Konkurrenzkampf im Hinblick auf Ausbau und Preisentwicklung durchgesetzt haben, − Sonne und Wind – durch eine fluktuierende Stromerzeugung gekennzeichnet, d.h. deren Erzeugungsmengen schwanken stark und lassen sich nicht immer ausreichend genau prognostizieren. Zweitens werden diese erneuerbaren Technologien dezentral und somit oftmals lastfern ausgebaut. Dementsprechend sind die Erzeugungsstandorte über das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verstreut, nicht überall scheint aber gleichzeitig die Sonne oder weht der Wind. Allein dies macht schon einen Abtransport des Stroms notwendig, solange dieser nicht in großen Mengen zwischengespeichert werden kann. Zudem wird es in Zukunft in Regionen ohne starke Verbrauchszentren, im Sinne großer Industrieanlagen oder Großstädten, immer häufiger zu starken Überproduktionen an Strom kommen, wenn dort große Mengen erneuerbarer Energien zugebaut wurden. Soll es nicht zu einer wirtschaftlichen Entwertung dieser Anlagen kommen, die in der Konsequenz abgeregelt werden müssten sollte der Strom nicht zu den Verbrauchszentren transportiert werden können, ist also auch aus diesem Grund der Netzausbau unerlässlich. Regionen, die dieses Problemprofil aufweisen oder es in Zukunft aufweisen werden, sind insbesondere im Norden und Osten Deutschlands anzutreffen, wo nicht das Ausmaß an Bevölkerungsreichtum und energieintensiver Industrie anzutreffen ist wie im Süden Deutschlands. Der mittelfristig stärkere Ausbau der offshore-Windenergie wird dieses Problem noch verschärfen.
Die Netzinfrastruktur in Deutschland: Grundlagen und Charakteristiken
Fluktuierende Einspeisung in das Stromnetz ist deshalb problematisch, weil Elektrizität im Stromnetz nicht gespeichert werden kann – der Strom muss genau zu dem Zeitpunkt erzeugt werden, indem er auch verbraucht wird. Die sich daraus ergebende Netzfrequenz ist 50 Hertz, die sich nur einstellt, wenn sich Stromerzeugung und -verbrauch im Gleichgewicht befinden.[67] Übertragung und Verteilung von Strom sind zwei Aufgaben mit denen sich je spezifische Eigenschaften verbinden. Haushaltsgeräte beziehen den Strom aus der Steckdose mit einer Spannung von 0,23 Kilovolt (kV). Würde der Strom mit dieser Spannung über große Distanzen übertragen werden, wären die Verluste enorm. Aus diesem Grund wird, um eine möglichst verlustarme Übertragung zu garantieren, der Strom mit einer sehr hohen Spannung von bis zu 380 kV transportiert. Bevor er verbraucht werden kann, wird er zuvor umgespannt. Die unterschiedlichen Charakteristiken der Aufgaben haben deshalb ein Verbundnetz mit unterschiedlichen Netz- bzw. Spannungsebenen entstehen lassen. Es lassen sich folgende Ebenen unterscheiden:
- Höchstspannung (HöS) mit Betriebsspannungen von 220 kV und 380 kV
- Hochspannung (HS) mit Betriebsspannungen > 60 bis < 220 kV
- Mittelspannung (MS) mit Betriebsspannungen zwischen 6 und ≤ 60 kV
- Niederspannung (NS) mit einer Betriebsspannung von 0,4 kV
Das deutsche Stromnetz ist alt, man möchte sagen, es ist in die Jahre gekommen. Das Durchschnittsalter der Höchstspannungsleitungen hat die 35 Jahre-Marke übersprungen.[69] Wie bei allen großen Infrastrukturprojekten amortisieren sich die Investitionen über viele Jahre, es muss irgendwann aber zwangsläufig erneuert werden. Die meisten dieser Investitionszyklen nähern sich ihrem Ende. Dies ist einer der Gründe, warum die Energiewende nicht die einzige Ursache für den notwendigen Ausbau des Stromnetzes ist. Studien belegen, dass in der Vergangenheit sogar mehr Geld in den Leitungsausbau geflossen ist. „Die Folge der geringen Investitionen in die Stromnetze ist ein erheblicher Modernisierungs- und Investitionsstau. Eine eindeutige Trennung zwischen den durch die Energiewende induzierten Netzausbaukosten und Kosten durch Versäumnisse in der Vergangenheit ist nicht möglich.“[70] So hat die Deutsche Energie Agentur (dena) in zwei Netzstudien aus den Jahren 2005 und 2010 einen Netzausbaubedarf von 850 Kilometern bis 2015 und bis 2020 3600 Kilometern an Höchstspannungsleitungen ermittelt.[71] Die dena-Netzstudie I diente als Grundlage für das im Jahr 2009 verabschiedete Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG), in dem 23 (ursprünglich 24) zusätzliche Leitungsausbauprojekte aufgenommen wurden. Somit befanden sich schon lange vor der Entscheidung für eine beschleunigte Energiewende der Ausbau von Höchstspannungsstrecken ganz oben auf der Prioritätenliste.[72] Jedoch befinden sich diese Ausbaupläne, die sich noch unter der Regie der Bundesländer stehen, in starkem Verzug: Von den insgesamt vorgesehenen 1876 Kilometern sind erst 322 Kilometer fertig gestellt – dabei sollte ein Großteil der Vorhaben 2015 fertiggestellt sein.[73]Dies baut zusätzlichen Handlungsdruck auf und hat in der öffentlichen Diskussion dazu geführt, dass der Netzausbau als Achillesferse der Energiewende wahrgenommen wird.
Der Ausbaubedarf, der nun aber einwandfrei mit der Energiewende in Zusammenhang gebracht werden kann, wurde im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) aus dem Jahr 2013 festgehalten und beschlossen. Hier ist die schon beschriebene Notwendigkeit, Strom aus den Windregionen im Norden und Osten Deutschlands in die Verbrauchszentren nach Süden zu transportieren, dafür verantwortlich, dass mehrere Höchstspannungs-Gleichstrom-Leitungen (HGÜ) geplant sind. Das BBPlG formuliert eine energiewirtschaftliche Bedarfsfeststellung von 2800 Kilometern an kompletten Neubautrassen sowie 2900 Kilometern an Optimierungs- und Verstärkungsmaßnahmen. Entscheidend ist bei dem Gesetz, dass es ausdrücklich die energiewirtschaftliche Notwendigkeit der Projekte feststellt, um somit Klagen gegen die Trasse unter Rückgriff eben jener nichtvorhandener Notwendigkeit zu verhindern. Entscheidend ist darüber hinaus, dass auf Grundlage des Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) im BBPlG den Ländern die Planungskompetenz entzogen und auf die Bundesnetzagentur (BNetzA) übertragen wird. Dementsprechendes Ziel des Gesetzes, ist eine Beschleunigung des Trassenausbaus. Doch wie funktioniert der Bau einer neuen Trasse nun genau?
Vom leeren Blatt Papier zur fertigen Trasse: Übersicht der Planungs- und Genehmigungsverfahren
Um diese Frage beantworten zu können, muss grundsätzlich differenziert werden, ob es sich dabei um ein Vorhaben nach dem EnLAG mit landesinterner Qualität oder einem Vorhaben mit landesübergreifender bzw. grenzüberschreitender Qualität nach NABEG handelt. Je nachdem ergeben sich differierende Zulassungsverfahren, weil unterschiedliche Behörden für die Genehmigung der Vorhaben zuständig sind. Bei der folgenden Darstellung bleibt zudem die Verteilnetzebene komplett ausgeblendet.
Eine entscheidende Rechtsquelle für den verfahrensrechtlichen Rahmen des Stromnetzausbaus ist das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Hier ist festgelegt, auf welcher Grundlage sich die energiewirtschaftliche Bedarfsfeststellung zu vollziehen hat. Demnach sind die Genehmigungsverfahren mehrstufig ausgestaltet.[74]
- Zu Beginn steht die Entwicklung eines Szenariorahmens, in dem die ÜNB den Stromverbrauch in den kommenden zehn bzw. zwanzig Jahren prognostizieren. Der Entwurf des wahrscheinlichen Stromverbrauchs, dem mindestens drei verschiedene Entwicklungspfade zu Grunde liegen, wird durch die Öffentlichkeit konsultiert und anschließend von der BNetzA unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung genehmigt.
- Darüber hinaus fließen die Bedarfsannahmen aus den vorhandenen Offshore-Netzplänen und dem EU-gemeinschaftsweiten Zehn-Jahres-Netzentwicklungsplan in den Entwurf eines nationalen Netzentwicklungsplan (NEP) ein, der von den ÜNB jährlich aufgestellt wird. Auch der NEP wird öffentlich zur Konsultation gestellt und von der BNetzA gemäß dem EnWG geprüft.
- Für den Fall, dass ein Bundesbedarfsplan erstellt werden soll – was mindestens alle drei Jahre vorgesehen ist –, fertigt die BNetzA entsprechend der Umweltverträglichkeitsprüfung einen Umweltbericht zu jedem Leitungsprojekt an. Auch in diesem Schritt wird der NEP und der Umweltbericht der Öffentlichkeit bekannt gemacht, um Stellungnahmen in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. Zum Entwurf des NEP 2012 gingen beispielsweise über 3300 Stellungnahmen ein, die in die Prüfung der BNetzA mit eingeflossen sind.[75] Die BNetzA bestätigte schließlich 51 von insgesamt 74 im NEP von den ÜNB vorgesehenen Maßnahmen.
- Der bestätigte NEP wird dem Gesetzgeber durch die BNetzA vorgelegt und im Bundestag beraten und daraufhin als Bundesbedarfsplangesetz beschlossen. Der Bundesbedarfsplan kennzeichnet die als länderübergreifend markierten Leitungsausbauprojekte und ordnet so die Projekten den verantwortlichen Zulassungsbehörden zu – zur Erinnerung: Bei länderübergreifenden Vorhaben ist die BNetzA verantwortlich, ansonsten die Landesbehörden. Der weitere Verlauf der Genehmigungsverfahren wird ausschließlich für diese Vorhabenart beschrieben. Die folgende Abbildung fasst die Ermittlung des Ausbaubedarfes zusammen.
- Die Vorhabenträger, was im Falle vom Übertragungsnetz immer die ÜNB sind, stellen bei der BNetzA einen Genehmigungsantrag im Rahmen der Bundesfachplanung. Da der Bundesbedarfsplan ausschließlich Start- und Endpunkt der Trassenausbauprojekte bestimmt, beginnen die ÜNB mit einer Grobkorridorplanung, in der die Trasse verlaufen kann. Dieser Grobkorridor weist eine Breite von 15 Kilometern auf. Zudem weisen die ÜNB alternative Trassenführungen aus, die alle nicht nur technische und wirtschaftliche Aspekte, sondern auch die Auswirkungen auf Mensch, Natur und Landschaftsbild berücksichtigen.[76] Die Grobkorridorplanung wird von den ÜNB oftmals bereits für eine informelle Öffentlichkeitsbeteiligung genutzt, in der Anwohner und Betroffene zur Stellungnahme eingeladen werden. Die formale Öffentlichkeitsbeteiligung beginnt dann mit einer öffentlichen Antragskonferenz, auf der der Vorzugskorridor der ÜNB vorgestellt wird. „Bei der Konferenz werden Informationen zur Umwelt- und Raumverträglichkeit des Vorzugskorridors und dessen Alternativen gesammelt. Im Ergebnis wird nach der Antragskonferenz in einem Untersuchungsrahmen festgelegt, welche Unterlagen und Gutachten der Übertragungsnetzbetreiber noch vorlegen muss.“[77] Im Rahmen der Bundesfachplanung gibt es eine erneute strategische Umweltprüfung, die nun entlang des konkreten Trassenkorridors die Auswirkungen auf Mensch und Natur untersuchen kann. Im Ergebnis der Bundesfachplanung entscheidet die BNetzA über einen konkreten Trassenkorridor, der eine Breite von 500 bis 1000 Metern aufweist, innerhalb dessen die Stromleitung gebaut wird. Diese festgelegten Trassenkorridore sind für das Planfeststellungsverfahren verbindlich und werden in den Bundesnetzplan aufgenommen.
- Das Planfeststellungsverfahren für länderübergreifende Projekte wird von der BNetzA durchgeführt und beginnt mit einem Antrag der Vorhabenträger auf Planfeststellungsbeschluss. In diesem Schritt findet erneut eine Güterabwägung statt, in der sich Träger öffentlicher Belange, Bürger und Vereinigungen (bspw. Naturschutzverbände) einbringen können. Der Planfeststellungsbeschluss ergeht innerhalb des Trassenkorridors, der im Bundesnetzplan ausgewiesen ist. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Planungs- und Genehmigungsverfahren beim netzausbau.
- Anschließend beginnen die ÜNB das Projekt zu realisieren.
[i] Stephan Zitzler ist Master-Absolvent des Masterprogramms „Politkmanagement, Public Policy & öffentliche Verwaltung“ der NRW School of Governance. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Politikfeldforschung und der Energiepolitik.
[1] FAZ (07.02.2014): Duin: Seehofer ist ein energiepolitischer Irrläufer, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 32, S. 1.
[2] SZ (12.02.2014): Eigenes Naturell, in: Süddeutsche Zeitung-Landkreisausgaben, S. 37.
[3] SZ (06.02.2014): Die Wende nach der Wende, in Süddeutsche Zeitung, S. 2.
[4] FAZ (06.02.2014): Bayern zieht Stromnetzausbau in Zweifel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 31, S. 9.
[5] FAZ (07.02.2014): Duin: Seehofer ist ein energiepolitischer Irrläufer, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 32, S. 1.
[6] SPON (10.02.2014): SPD fordert Merkel-Machtwort zum Netzausbau, in: Spiegel online, abrufbar unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/energiewende-spd-fordert-machtwort-von-merkel-zum-netzausbau-a-952442.html (Stand 30.04.2014).
[7] http://www.netzausbau.de/cln_1432/DE/Wissenswertes/WarumNetzausbau/WarumNetzausbau-node.html;jsessionid=99594BA336560D59CF1786B3EF36CFD7 (Stand 30.04.2014).
[8] FAZ (06.02.2014): Bayern zieht Stromnetzausbau in Zweifel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 31, S. 9.
[9] SZ (19.03.2014): CSU rutscht unter 40 Prozent, in Süddeutsche Zeitung online, abrufbar unter http://www.sueddeutsche.de/bayern/kommunalwahl-csu-rutscht-unter-prozent-1.1917259 (Stand 30.04.2014).
[10] FAZ (01.04.2014): Süddeutsche Länder fürchten „Diktat des Nordens“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 77, S. 4.
[11] Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz, abrufbar unter http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/nabeg/gesamt.pdf (Stand 30.04.2014).
[12] Montag, Tobias (2012): Netzausbau ohne Bürger? Die Neuregelungen für den Ausbau von Höchstspannungsleitungen als Vorbild für Bürgerbeteiligung bei Großprojekten, abrufbar unter http://www.kas.de/wf/doc/kas_31135-544-1-30.pdf?120523170151 (Stand 30.04.2014) und FAS (03.06.2012): Im Netz der Bürgerproteste, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 22, S. 38.
[13] SZ (06.02.2014): Die Wende nach der Wende, in: Süddeutsche Zeitung, Bayern, S. 2.
[14] http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Presse/Reden/2013/Homann130827HandelsblattJahrestagungErneuerbareEnergien2013.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (Stand 07.05.2014).
[15] http://www.transnetbw.de/de/uebertragungsnetz/dialog-netzbau/sued-link (Stand 07.05.2014).
[16] http://www.50hertz.com/en/3700.htm (Stand 07.05.2014).
[17] http://www.50hertz.com/en/3700.htm (Stand 07.05.2014).
[18] http://www.amprion.net/netzausbau/gleichstrompassage-sued-ost-hintergrund (Stand 07.05.2014).
[19] http://suedlink.TenneT.eu/projektstand.html (Stand 07.05.2014).
[20] http://www.netzausbau.de/cln_1411/DE/Vorhaben/EnLAG-Vorhaben/EnLAG-04/EnLAG-04-node.html;jsessionid=25F4B37A1CAA18CA8B9B17BD80357B50 (Stand 07.05.2014).
[21] http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/thueringer-strombruecke-bundesverwaltungsgericht-weist-klagen-gegen-stromtrasse-ab-1.1725351 (Stand 07.05.2014).
[22] http://www.np-coburg.de/regional/franken/schauplatzregionnp/Hochspannung-im-Coburger-Land;art83463,2632706 (Stand 07.05.2014).
[23] SPON (04.04.2014): Seehofer und die Energiewende: Bayerns Angst vor der Monstertrasse, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/energiewende-seehofer-kuendigt-kampf-gegen-gleichstromtrasse-an-a-962682.html (Stand 07.05.2014).
[24] http://www.np-coburg.de/regional/franken/frankenbayern/Oberfranken-streiten-ueber-Stromleitung;art83462,3100924 (Stand 07.05.2014).
[25] Ebd.
[26] SZ (19.02.2014): Hochspannung, in: Süddeutsche Zeitung, S. 3.
[27] Ebd.
[28] http://www.trassenwahn1701.de/fakten-und-ziele (11.05.2014).
[29] http://www.bfs.de/de/elektro/netzausbau/schutz/grenzwerte.html (11.05.2014).
[30] SZ (19.02.2014): Hochspannung, in: Süddeutsche Zeitung, S. 3.
[31] Montag, Tobias (2012): Netzausbau ohne Bürger? Die Neuregelungen für den Ausbau von Höchstspannungsleitungen als Vorbild für Bürgerbeteiligung bei Großprojekten, abrufbar unter http://www.kas.de/wf/doc/kas_31135-544-1-30.pdf?120523170151 (Stand 30.04.2014).
[32] http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nz-news/neue-stromtrasse-durch-franken-1.3214052 (08.05.2014).
[33] http://www.donaukurier.de/lokales/neuburg/Neuburg-Die-Karte-ist-voellig-unbrauchbar;art1763,2868914 und http://www.augsburger-allgemeine.de/donauwoerth/Die-Buergermeister-sind-geladen-id28605422.html (Stand 11.05.2014).
[34] Montag, Tobias (2012): Netzausbau ohne Bürger? Die Neuregelungen für den Ausbau von Höchstspannungsleitungen als Vorbild für Bürgerbeteiligung bei Großprojekten, abrufbar unter http://www.kas.de/wf/doc/kas_31135-544-1-30.pdf?120523170151 (Stand 30.04.2014).
[35] SZ (19.02.2014): Hochspannung, in: Süddeutsche Zeitung, S. 3.
[36] Montag, Tobias (2012): Netzausbau ohne Bürger? Die Neuregelungen für den Ausbau von Höchstspannungsleitungen als Vorbild für Bürgerbeteiligung bei Großprojekten, abrufbar unter http://www.kas.de/wf/doc/kas_31135-544-1-30.pdf?120523170151 (Stand 30.04.2014).
[37] SZ (31.02.2014): Seehofer bremst Stromautobahnen, in: Süddeutsche Zeitung, Landkreisausgaben, S. 49.
[38] SZ (05.02.2014): Kabinett zieht den Stecker, in: Süddeutsche Zeitung, Landkreisausgaben, S. 33.
[39] Ebd.
[40] SZ (17.02.2014): Von Wolke sieben bis Gewitter, in: Süddeutsche Zeitung, Landkreisausgaben, S. 37.
[41] FAZ (21.03.2014): Brüchige Machtbasis, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 68, S. 1.
[42] SZ (19.02.2014): Hochspannung, in: Süddeutsche Zeitung, S. 3.
[43] FAZ (06.02.2014): Bayern zieht Stromnetzausbau in Zweifel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 31, S. 9.
[44] FAZ (21.03.2014): Die Problemleitung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 68, S. 8.
[45] http://www.bayern.de/Reden-Staatskanzlei-.1362.10489446/index.htm (Stand 11.05.2014).
[46] http://www.bayern.de/Reden-Staatskanzlei-.1362.10489446/index.htm (Stand 11.05.2014).
[47] FAZ (07.02.2014): Duin: Seehofer ist ein energiepolitischer Irrläufer, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 32, S. 1.
[48] SPON (05.02.2014): Seehofer kündigt den Atomausstieg auf, in: Spiegel online, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruener-energiewendeminister-habeck-attackiert-csu-chef-seehofer-a-951615.html (Stand 11.05.2014).
[49] FAZ (06.02.2014): Bayern zieht Stromnetzausbau in Zweifel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 31, S. 9.
[50] FAZ (08.02.2014): Friedrich für streckenweise unterirdische Stromtrassen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung online, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/leitungen-friedrich-fuer-streckenweise-unterirdische-stromtrassen-12791261.html (Stand 11.05.2014).
[51] FAZ (01.04.2014): Süddeutsche Länder fürchten „Diktat des Nordens“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 77, S. 4 und FAZ (06.02.2014): Bayern zieht Stromnetzausbau in Zweifel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 31, S. 9.
[52] SPON (06.02.2014): Oettinger kritisiert Seehofers Stromnetz-Moratorium, in: Spiegel online, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/oettinger-kritisiert-seehofers-stromnetz-moratorium-a-951950.html (Stand 11.05.2014).
[53] FAZ (08.02.2014): Merkel: Es wird große Stromtrassen geben, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung online, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kanzlerin-gegen-moratorium-beim-netzausbau-merkel-es-wird-grosse-stromtrassen-geben-12791484.html (Stand 11.05.2014).
[54] SPON (08.02.2014): Seehofer will Kernpunkte der Energiewende neu verhandeln, in Spiegel online, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/seehofer-will-kernpunkte-der-energiewende-neu-verhandeln-a-952220.html (Stand 11.05.2014).
[55] CDU, CSU und SPD (2013): Deutschlands Zukunft gestalten, abrufbar unter: https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf, S. 2.
[56] FAZ (10.02.2014): Stegner: Merkel muss Seehofer zur Ordnung rufen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung online, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/streit-ueber-stromtrassen-stegner-merkel-muss-seehofer-zur-ordung-rufen-12793742.html (Stand 09.05.2014).
[57] FAZ (08.02.2014): Merkel: Es wird große Stromtrassen geben, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung online, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kanzlerin-gegen-moratorium-beim-netzausbau-merkel-es-wird-grosse-stromtrassen-geben-12791484.html (Stand 11.05.2014).
[58] FAZ (14.02.2014): Streit über Stromtrassen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 38, S. 4.
[59] SZ (12.02.2014): Altmaier muss Strom-Streit schlichten, in: Süddeutsche Zeitung online, abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-stromtrassen-altmaier-muss-strom-streit-schlichten-1.1886154 (11.05.2014).
[60] FAZ (08.02.2014): Friedrich für streckenweise unterirdische Stromtrassen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung online, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/leitungen-friedrich-fuer-streckenweise-unterirdische-stromtrassen-12791261.html (11.05.2014).
[61] FAZ (07.02.2014): Huber: Seehofer hat neue Trassen nicht infrage gestellt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung online, abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/energiewende-huber-seehofer-hat-neue-stromtrassen-nicht-infrage-gestellt-12789937.html (11.05.2014).
[62] SZ (25.02.2014): Seehofers Regierung verstrickt sich in Widersprüchen, in: Süddeutsche Zeitung online: abrufbar unter: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energiewende-seehofers-regierung-verstrickt-sich-in-widersprueche-1.1897477 (Stand 09.05.2014).
[63] SPON (04.04.2014): Seehofer und die Energiewende: Bayerns Angst vor der Monstertrasse, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/energiewende-seehofer-kuendigt-kampf-gegen-gleichstromtrasse-an-a-962682.html (Stand 07.05.2014).
[64] FAZ (07.02.2014): Gegenwind für Bayerns Ausbaustopp für Stromleitungen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 32, S. 16.
[65] FAZ (10.02.2014): Energiewende: Merkel nimmt Seehofer Wind aus den Segeln, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 34, S. 19 und http://www.mdr.de/mdr-info/stromtrassen104.html (Stand 11.05.2014).
[66] Montag, Tobias (2012): Netzausbau ohne Bürger? Die Neuregelungen für den Ausbau von Höchstspannungsleitungen als Vorbild für Bürgerbeteiligung bei Großprojekten, abrufbar unter http://www.kas.de/wf/doc/kas_31135-544-1-30.pdf?120523170151 (Stand 30.04.2014), S. 6.
[67] Kästner, Thomas/ Kießling, Andreas (2009): 60 Minuten Energie. Ein Reiseführer durch die Stromwirtschaft, Wiesbaden, S. 62f.
[68] Bundesnetzagentur (2012): Monitoringbericht 2011, Bonn, S. 87 mit aktualisierten Zahlen aus Bundesnetzagentur (2014): Monitoringbericht 2014, Bonn.
[69] Bundesnetzagentur (2011): Bericht zur Auswertung der Netzzustands- und Netzausbauberichte der deutschen Elektrizitätsübertragungsnetzbetreiber, Bonn, S. 33.
[70] http://www.iwr-institut.de/de/presse/presseinfos-energiewende/stromnetz-ausbau-laesst-strompreise-steigen-netzentgelte-auf-6-jahrestief (Stand 06.05.2014).
[71] Deutsche Energie Agentur (2005): dena-Netzstudie. Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis 2020, Köln sowie Deutsche Energie Agentur (2010): dena-Netzstudie II. Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015 – 2020 mit Ausblick 2025, Berlin.
[72] http://www.netzausbau.de/cln_1431/DE/Wissenswertes/Recht/EnLAG/enlag_node.html;jsessionid=939E1A4860B69A34CD46578AABF3C762 (Stand 06.05.2014).
[73] FAZ (23.04.2014): Der Stromnetzausbau gerät in Verzug, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 94, S. 16; vgl. auch http://www.netzausbau.de/cln_1431/DE/Vorhaben/EnLAG-Vorhaben/EnLAGVorhaben-node.html (Stand 06.05.2014).
[74] Vgl. im Folgenden http://www.netzausbau.de/cln_1431/DE/Wissenswertes/Recht/Recht-node.html (Stand 06.05.2014) sowie NABEG a.a.O. und BBPlG a.a.O.
[75] http://www.netzausbau.de/cln_1431/DE/BundesweitePlaene/Alfa/NEP-UB_Alfa/NEP-UB_Alfa-node.html jsessionid=6D69F2157C1426582E3F513D42A46634 (Stand 06.05.2014).
[76] http://www.netzausbau.de/cln_1431/DE/Verfahren/Bundesfachplanung/Bundesfachplanung-node.html (Stand 06.05.2014).
[77] Ebd.