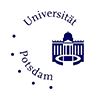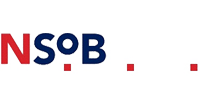Der Politikwissenschaftler Frank Nullmeier betrachtet die Agenda 2010 unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitsmarktreform. Ein grundsätzliches Problem im Rahmen der Politik der Agenda 2010 sieht Nullmeier darin, dass zwar ein enger innerer Zirkel rund um Bundeskanzler Schröder existierte, der die Reformen wirksam vorantrieb. Gleichzeitig ließ sich der eingeschlagene Reformkurs jedoch weder der rot-grünen Koalitionsregierung noch der SPD als Partei klar zuordnen. Letztendlich liege, so Nullmeier, in der fehlenden Rückbindung der Reformen einer der Hauptgründe, warum Kanzler Schröder die Unterstützung durch die eigene Parteibasis und die Wähler verloren ging.
1 »Agenda 2010« als Reformpaket
Im September 2007 forderte der Parteivorsitzende der SPD, Kurt Beck, die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I für ältere Arbeitnehmer zu erhöhen. Dieser Position widersprach der damals amtierende SPD-Arbeitsminister Franz Müntefering. Die Kontroverse wurde in der SPD und in der breiteren Öffentlichkeit als Auseinandersetzung um die »Agenda 2010« gewertet, war doch unter diesem Label neben vielen anderen Maßnahmen auch die Herabsetzung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld auf ein Jahr eingeführt worden. Mit dem Ausdruck »Weiterentwicklung der Agenda-Politik« wurde in der Folgezeit versucht, den Disput zu entschärfen.
Neuerlich hatte sich damit ein Disput über eine seit ihrem Beginn im Jahre 2003 umstrittene Politik entzündet. Der andauernde Konflikt um die Agenda-Reformen verweist auf Defizite in der strategischen Qualität des Agenda-2010-Prozesses. Wie genau es um dessen strategische Qualität bestellt ist, kann anhand der Dimensionen Durchsetzungsfähigkeit, Kommunikation und Kompetenz des SPR genauer betrachtet und wissenschaftlich bewertet werden.
Dabei ist allerdings eine Besonderheit der Agenda-Politik zu beachten: Es herrscht noch immer Unklarheit darüber, was die »Agenda 2010« ausmacht. Das lässt sich auch am oben angeführten Beispiel verdeutlichen: Kann die Revision einer einzelnen Maßnahme bereits als Bruch mit der Agenda gewertet werden? Ist die kurze Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes der Kern des politischen Projekts »Agenda 2010«? Noch vier Jahre nach Beginn der Agenda-Politik scheint kein grundlegend konsensuales Verständnis in der politischen Öffentlichkeit über den Kern, die Identität und die thematische Reichweite der Agenda 2010 zu bestehen.
1.1 Politisches Markenzeichen oder umfassendes Reformkonzept?
Der Begriff »Agenda 2010« wurde geprägt als Titel für ein Reformpaket, das Bundeskanzler Gerhard Schröder am 14. März 2003 dem Deutschen Bundestag in einer Art nachgeholter Regierungserklärung zur zweiten rot-grünen Koalition präsentierte. Der Terminus »Agenda 2010« taucht in dieser Rede nur an zwei Stellen auf. Nach den außen-, sicherheits- und europapolitischen Ausführungen, die unter dem Motto »Mut zum Frieden« stehen, wird auf die Notwendigkeit der grundlegenden und schnelleren Reform des Sozialstaates verwiesen.
»Mut zur Veränderung« ist die Formel, die diesen zweiten Teil der Rede pointieren soll. Im Anschluss an den Hinweis, dass zur Anpassung an veränderte Bedingungen noch schnellere Veränderungen der einzelnen Politiken erforderlich seien, wird der folgende, einleitende Satz vorgetragen: »Unsere Agenda 2010 enthält weit reichende Strukturreformen.« Die langen, in drei Abschnitte gegliederten Ausführungen zu einzelnen Reformfeldern und -maßnahmen schließen dann mit dem Satz: »Ich habe das, was ich ›Agenda 2010‹ genannt habe, vorgestellt.«
Der das gesamte Politikmarketing der Bundesregierung in den nächsten Jahren bestimmende Begriff wird mithin in seiner Einführungsrede nur in einleitenden oder reflexiv die eigene Rede resümierenden Sätzen verwendet. Es gibt keine Definition des Begriffs, sei sie abstrakt oder nur additiv, keine Umschreibung des Gesamtgehalts, keine Versuche, Wertbegriffe wie Gerechtigkeit, Solidarität oder Freiheit direkt mit dem Terminus Agenda zu verbinden, keine Begründung der Wahl dieses Begriffs und auch keine indirekte Bestimmung durch Abgrenzung von anderen Politikentwürfen. Selbst die Schreibweise (Groß- oder Kleinschreibung von »Agenda«) und Aussprache (»zwanzigzehn« oder »zweitausendzehn«) sind anfangs uneinheitlich.
1.2 Politikfelder und Reformbündelung
Welche Politikfelder und Gesetzgebungsmaterien die Agenda 2010 umfasst, wurde nie einheitlich festgelegt. Die im November 2003 vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung verbreitete Broschüre »Antworten zur agenda 2010« benennt acht Felder: Wirtschaft, Ausbildung, Steuern, Bildung und Forschung, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Rente und Familienförderung (Presse- und Informationsamt 2003). Definitorisch werden sie wie folgt auf den Begriff Agenda 2010 bezogen: »Die Regierung handelt, damit Wachstum und Beschäftigung wieder steigen, die Sozialsysteme zukunftsfest umgebaut werden und der Standort Deutschland noch attraktiver wird. In der agenda 2010 sind alle Strukturreformen gebündelt, die zum Erreichen dieser Ziele notwendig sind« (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2003: 8).
Gerhard Schröder (2007: 393 – 397) nennt rückblickend die folgenden sieben Reformfelder: Arbeitsmarktpolitik, Kündigungsschutz, Tarifrecht, Ausbildung, Modernisierung der Handwerksordnung, Gesundheitsreform, Steuer- und Investitionspolitik.
In der Regierungserklärung vom 14. März 2003 gliedert sich die Agenda-Politik in drei Bereiche: Konjunktur und Haushalt als erster Bereich umfasst Konzepte der Haushaltskonsolidierung, der steuerlichen Entlastung und der Entwicklung konjunktureller Impulse. Der zweite Bereich, Arbeit und Wirtschaft, wird als »Herzstück unserer Reformagenda« beschrieben. Arbeitsmarktflexibilisierung, Umbau der Bundesagentur für Arbeit und die weiteren bekannten Elemente der Hartz-Reformen werden hier benannt.
Darauf folgend wird die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe angesprochen, nun mit dem Hinweis, dass die neue einheitliche Leistung »in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe entsprechen wird«. Nach dieser Klarstellung zum Niveau der später unter dem Namen Arbeitslosengeld II (ALG II) bekannt gewordenen Leistungen werden zum Bereich Arbeit und Wirtschaft auch noch Veränderungen im Arbeits- und Sozialrecht (insbesondere Kündigungsschutzrecht) gerechnet, die Beschäftigungshemmnisse verringern sollen, sowie Maßnahmen gegen die Schwarzarbeit. Förderung des Mittelstandes, Handwerksordnung, Öffnungsklauseln im Tarifrecht, betriebliche Bündnisse und berufliche Ausbildung sind die nächsten Programmpunkte.
Der dritte Bereich erhält in der Rede keinen eigenen Titel. Soziale Sicherung, Umbau des Sozialstaates, Senkung der Lohnnebenkosten, Reform der Alterssicherung und des Gesundheitswesens sind die zentralen Stichworte in diesem dritten Feld der Agenda. Erst nachdem die Schlussformel »Ich habe das, was ich ›Agenda 2010‹ genannt habe, vorgestellt« gesprochen war, folgte noch ein Abschnitt zu Bildung und Forschung. Im Unterschied zur regierungsoffiziellen Kommunikation, aber im Einklang mit dem Aufbau der AgendaRede zählt Gerhard Schröder auch in seinen Memoiren Bildung und Forschung nicht zur Agenda 2010.
Von den drei Bereichen, die Bundeskanzler Schröder in seiner Rede genannt hat, stand der erste, Konjunktur und Haushalt, in der öffentlichen Rezeption immer im Schatten der Arbeitsmarktreformen und der Umstrukturierung der sozialen Sicherungssysteme. Die Familienförderung in die Agenda 2010 aufzunehmen, wie es die angeführte Broschüre tat, ist eine Erweiterung des Agenda-Konzeptes der Regierungserklärung, die sich auf keine ernsteren Anhaltspunkte in dieser Rede berufen kann. Derartige Veränderungen deuten eher darauf hin, dass es in der Regierung für einzelne Ministerien und deren Öffentlichkeitsarbeit attraktiv erschien, das eigene Politikthema auf die Agenda aufzusatteln.
Damit wird das ohnehin sehr weit gespannte Konzept in Richtung Kontur- bzw. Grenzenlosigkeit weitergetrieben. Die Öffentlichkeit erhielt noch mehr Möglichkeiten, sich aus dem Gesamtrahmen einzelne Maßnahmen ›herauszupicken‹, die (für einzelne soziale Gruppen oder Interessen) als zentral für die Agenda 2010 angesehen werden konnten. Die Hoheit über die Rezeption des Begriffsumfangs der Agenda im Sinne von Issues oder Policys lag daher nicht mehr bei der Bundesregierung.
Zugleich war nicht gesichert, dass die Agenda-Politik als wirklich integriertes Gesamtkonzept zu verstehen war. Der Hervorhebung einzelner Felder entspricht die Vernachlässigung oder Ausblendung anderer. Ob die genannten Felder als politisch gleichwertig zu betrachten waren oder nicht, wird am ehesten noch durch den Begriff »Herzstück« für die Arbeitsmarktdimension in der Agenda-Rede geklärt. Weitergehende Hierarchisierungen, Zu- oder Gleichordnungen fehlen. Es existierte keine eingängige Formel, die hätte erklären können, warum die verschiedenen Reformfelder notwendigerweise zusammengehörten. Folglich konnte nur ad hoc auf den inneren Zusammenhang der Reformen verwiesen werden.
So dürfte sich in der Öffentlichkeit ein Bild der Agenda herausgebildet haben, das durch die Rede und die nachfolgende Regierungskommunikation nicht tiefgehend kognitiv vorstrukturiert war. In der Folge setzte sich das Etikett Agenda 2010 zwar sehr erfolgreich als Bezeichnung für die Regierungspolitik in der zweiten Legislaturperiode durch, jedoch weniger als Programmbegriff denn als emotional höchst polarisierendes Wort, das mit recht divergierenden Einschätzungen einzelner Teilreformen in Beziehung gesetzt werden konnte.
1.3 Historie der Agenda 2010
In seinen Memoiren stellt Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder die Entscheidung zugunsten der Agenda 2010 als Folge des Scheiterns des bisherigen Politikmodells der rot-grünen Koalition dar: »In der letzten Sitzung des Bündnisses für Arbeit im März 2003 kristallisierte sich endgültig heraus, dass bei den beteiligten Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften keinerlei Bereitschaft bestand, aufeinander zuzugehen. Die Politik, die beide Gruppen im Bündnis gemacht hatten, nämlich keine eigenen Beiträge zu liefern, sondern nur den Versuch zu unternehmen, die Regierung für die eigenen Ziele zu instrumentalisieren, wurde weitergeführt. Daraufhin habe ich das Bündnis selbst für gescheitert erklärt und den Beteiligten deutlich gesagt, die Regierung werde nun allein handeln müssen, um die notwendigen Reformen voranzubringen. Vierzehn Tage später stellte ich dann im Deutschen Bundestag mein Modernisierungsprogramm der Agenda 2010 vor« (Schröder 2007: 90f.).
Damit ist ein spezifischer Ausgangspunkt der Reformen benannt: Die Agenda-Politik wurde nach dem Scheitern des Bündnisses für Arbeit bewusst als Machtstrategie – insbesondere gegen die Gewerkschaften und Teile der eigenen Partei – konzipiert. Kriterien wie Dialogorientierung und Einbeziehung wichtiger Akteure wurden daher bewusst nicht mehr als Maßstab des Reformhandelns anerkannt. Die Agenda 2010 war eine Konfliktstrategie, die Elemente der Konsensbildung und der langsamen Generierung von Zustimmung gerade ausschloss. Sie beendete eine Phase, in der Konsensstrategien als Basis des Regierungshandelns verstanden worden waren, und steuerte um auf Durchsetzung und Machtnutzung bei gezielter Umgehung potenziell widerständiger Akteure.
Die Politikfelder, die gemäß der Rede Gerhard Schröders zur Agenda zählten, waren mehr oder minder auch die zentralen Themenfelder der Bündnis-für-Arbeit-Politik. Das Bündnis für Arbeit war bereits als Bündelung und Zusammenführung eines sehr weit gespannten Bereichs von Politikfeldern gedacht. So kann in der Rückschau die Agenda 2010 durchaus als Fortführung desselben Policy-Bündelungskonzeptes verstanden werden – nur mit anderen Mitteln: statt korporatistischer Einbindung und Konsenspolitik nunmehr politische Durchsetzung auch gegen die Verbände, dafür im Einvernehmen mit der CDU/CSU-Opposition.
Bildete von 1998 bis 2002 ein neokorporatistisches Politikmodell das Ideal, so wurde mit der Agenda-Politik eine Konfliktstrategie implementiert, die gleichwohl ein starkes Konsenselement enthielt – nun jedoch nicht mehr auf der Ebene der Einbeziehung von Interessenverbänden, sondern über eine Politik des Parteienkonsenses zwischen den beiden großen Volksparteien.
Da eine Steuerung durch die Bundesregierung allein angesichts der Mehrheit der Union im Bundesrat nicht möglich war, wurde – entgegen dem Anschein, dass nun die Regierung allein zeige, wie es weitergehen müsse – eine neue Konsenspolitik gestartet, allerdings ohne diese öffentlich zu propagieren. Die Agenda-Politik konnte nur als faktische Große Koalition unter dem formellen Titel Rot-Grün fortgeführt werden. Entsprechend konsequent dürfte die Entscheidung zugunsten von Neuwahlen 2005 gewesen sein, um nunmehr eine faktische in eine formelle Große Koalition umzuwandeln (ähnlich: Zohlnhöfer und Egle 2007: 21).
Statt aber die Große Koalition als Zielsetzung zu propagieren, wurde diese politisch-prozessual unvermeidbare Zusammenarbeit mit der CDU/CSU als neuer eigener inhaltlicher Politikansatz vertreten. Was angesichts der mangelnden Durchsetzungsfähigkeit der rotgrünen Regierung eine neue Form der Konsensstrategie darstellte, wurde zugleich als neuer inhaltlicher Politikansatz (Agenda 2010) verstanden. Die direkte Zusendung eines die Agenda vorwegnehmenden 24-seitigen Strategiepapiers an Horst Seehofer (CSU) in den Weihnachtstagen des Jahres 2002, die weiteren Abstimmungen mit ihm in der Gesundheitspolitik sowie die Steuerung der gesundheitspolitischen Überlegungen in der Rürup-Kommission durch das Ministerium in Richtung einer Vorab-Passförmigkeit zu den Forderungen der Union unterstützen diese Interpretation ebenso wie die Verabschiedung fast aller wichtiger Reformen nach Kompromissen im Vermittlungsausschuss.
Als die Agenda-Politik im März 2003 ihren Anfang nahm, war ihr »Herzstück«, die Arbeitsmarktreform als Hartz-Prozess, bereits seit über einem Jahr in Gang gesetzt. Entsprechend ging die fachliche Dimension der Entwicklung und Prüfung von Handlungsalternativen und Politikinstrumenten dem hier zu analysierenden Reformprozess voraus. Man kann die Agenda 2010 als nachträgliche Reform des Kommunikationsansatzes der Arbeitsmarktreformen begreifen, man kann sie als Implementationsphase der Hartz-Gesetzgebung interpretieren oder als Bündelung verschiedener Reformstränge mit den Arbeitsmarktreformen im Zentrum. Die Besonderheit des Agenda-2010-Ansatzes liegt auf jeden Fall in der Überschreitung eines politikfeldspezifischen Reformansatzes, auch wenn die Bindung an die Arbeitsmarktpolitik als zentrales Reformfeld nie verloren ging.
Der Agenda-Politik ging die arbeitsmarktpolitische Wende des März 2002 voraus. Am 5. Februar 2002 wurde ein Prüfbericht des Bundesrechnungshofes über die Vermittlungstätigkeit der Bundesanstalt für Arbeit veröffentlicht: Rund sieben Prozent aller als Vermittlung verbuchten Vorgänge waren Falschzuordnungen. Die realen Vermittlungszahlen erwiesen sich als weitaus geringer. Im Zuge der sofort einsetzenden medialen Skandalisierung dieser statistischen Fälschungen wurde sichtbar, dass die Hauptarbeit der Bundesanstalt für Arbeit gerade nicht in der Vermittlung, sondern in der Verwaltung der Arbeitslosen lag.
Am 20. Februar 2002 erfolgte der Rückzug des langjährigen Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Bernhard Jagoda. Er wurde durch Florian Gerster ersetzt, der 2001 bereits maßgeblich die Kombilohndebatte mitgetragen hatte (Blancke und Schmid 2003: 228). Die öffentliche Aufmerksamkeit machte zudem sofortige gesetzgeberische Veränderungen möglich: Bereits am 22. März 2002 konnte der Bundesrat die Neuorganisation der Leitungsorgane der Bundesanstalt für Arbeit (Abschaffung des Präsidentenamtes, Neustrukturierung der Selbstverwaltung) sowie erste Instrumentenänderungen (Vermittlungsgutscheine, Erleichterung der Zulassung privater Arbeitsvermittler) beschließen.
Die Einsetzung der ›Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt‹ mit dem damaligen Personalvorstand der Volkswagen AG, Peter Hartz, als Vorsitzendem erfolgte bereits am 22. Februar 2002. Die Hartz-Kommission legte nach knapp einem halben Jahr intensiver Arbeit ihre Ergebnisse am 16. August 2002 der Öffentlichkeit vor. Mitten im Bundestagswahlkampf verständigte sich die Regierung auf eine weitgehende Umsetzung der Kommissionsvorschläge (21. August 2002). Bereits am 4. September 2002 wurden erste Gesetzgebungen auf den Weg gebracht (Blancke und Schmid 2003: 220).
Die Bundestagswahl vom 22. September 2002 ermöglichte eine zweite rot-grüne Regierungsperiode. In den Koalitionsverhandlungen wurde die Eins-zu-eins-Umsetzung der Hartz-Kommissions-Ergebnisse bestätigt. Die Koalitionsverhandlungen erwiesen sich als relativ kompliziert, da sie im Wahlkampf nicht thematisierte Finanzierungsprobleme der öffentlichen Haushalte deutlich werden ließen, ohne dass eine klare Antwortstrategie gefunden werden konnte. Dennoch wurden die Hartz I und II genannten Arbeitsmarktgesetze sehr schnell in den Bundestag eingebracht. Nach einem Vermittlungsausschussverfahren konnte die Gesetzgebung kurz vor Weihnachten noch abgeschlossen werden, sodass die Gesetzespakete Hartz I und II zum 1. Januar 2003 in Kraft treten konnten.
Die Gesetze Hartz III und IV wurden im Herbst 2003 im Bundestag verabschiedet und nach Anrufung des Vermittlungsausschusses wiederum kurz vor Weihnachten endgültig beschlossen. Hartz III trat in wesentlichen Teilen am 1. Januar 2004 in Kraft, das im Vermittlungsausschuss weiter verschärfte Hartz IV zum 1. Januar bzw. 1. April 2004 und 1. Januar 2005. Die Organisation der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe war zwischen Union und Regierung jedoch weiterhin umstritten und konnte Mitte 2004 im Vermittlungsausschuss durch das Gesetz zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II/Kommunales Optionsgesetz) zugunsten des Optionsmodells gelöst werden.
Der Agenda-Rede waren schwere Niederlagen bei den Landtagswahlen in Niedersachsen und Hessen (2. Februar 2003) vorausgegangen. Der Bundestagswahlsieg zahlte sich mithin nicht aus, sondern wurde von der schlechten Performanz der Regierungsparteien während der Koalitionsverhandlungen und der deutlich negativen ökonomischen Entwicklung überlagert. Dennoch stellte die Agenda für die Regierungsparteien eine überraschende Wende dar, die weder mit der Wahlkampfprogrammatik und -rhetorik noch mit den bisherigen Politiklinien ohne Probleme in Einklang zu bringen war.
Die Regierungsparteien stimmten der Agenda 2010 zwischen April und Juni 2003 zu. Auf einer Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen kam es zu einer überwältigenden Mehrheit zugunsten der Agenda 2010. Der Sonderparteitag der SPD führte letztlich zu einem ähnlichen Ergebnis, stand aber unter dem Eindruck einer Rücktrittsdrohung des Bundeskanzlers. Der Versuch der Parteilinken, ein Mitgliederbegehren zu starten, war vorher bereits gescheitert.
Bei den Abstimmungen im Bundestag kam es sowohl beim Gesundheitsreformgesetz als auch bei den Hartz-Gesetzen zu Gegenstimmen aus den Regierungsfraktionen. Schließlich legte Bundeskanzler Gerhard Schröder angesichts anhaltender Widerstände aus der Partei (Bochumer Parteitag) sein Amt als SPD-Vorsitzender am 6. Februar 2004 nieder. Mit der Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft konnte eine gewisse Beruhigung in der SPD erzielt werden.
Die Gewerkschaften stellten sich überwiegend gegen die AgendaPolitik. Doch war die Beteiligung der Mitgliedschaft beim gewerkschaftlichen Aktionstag am 24. Mai 2003 so gering, dass eine Politik der Basismobilisierung nicht fortgeführt werden konnte. Erst im Sommer 2004 kam es in Ostdeutschland zu großen Demonstrationen, die unter der problematischen Übernahme des Ausdrucks »Montagsdemonstrationen« vor allem gegen die Hartz-IV-Reform gerichtet waren. Ebenfalls im Sommer 2004 schlossen sich Gewerkschafter und Sozialdemokraten zu jenen Initiativen zusammen, die schließlich den Nukleus der im Januar 2005 gegründeten Partei »Arbeit und soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG)« bilden sollten (Zohlnhöfer und Egle 2007: 17).
Die Zufriedenheit mit der Regierungspolitik von Rot-Grün lag im Zeitraum von November 2002 bis September 2004 ständig zwischen –0,9 und –1,7 (Kornelius und Roth 2007: 37). Dies schlug sich auch in den gravierenden Wahlniederlagen der Regierungsparteien nieder, so in Sachsen (Stimmenanteil der SPD: 9,8 Prozent) und Brandenburg im September 2004 sowie im Februar 2005 in Schleswig-Holstein und im Mai 2005 in Nordrhein-Westfalen.
Eine Analyse und Bewertung des Reformprozesses unter strategischen Gesichtspunkten – neben dem Strategietool für politische Reformprozesse wird im Folgenden die Literatur zur Strategiefähigkeit (Schröder 2000; Raschke 2002; Nullmeier und Saretzki 2002; Dettling 2005; Speth 2005; Tils 2005; Fischer, Schmitz und Seberich 2007; Raschke und Tils 2007) und zur strategischen Kommunikation (Althaus 2002; Machnig 2002; Kamps und Nieland 2006; Kamps 2007; Machnig 2007) verwendet – muss den komplexen Entwicklungsprozess in mehrere Phasen zerlegen. Die politikwissenschaftliche Phasenheuristik wird dabei auf die gesamte Agenda-Politik angewandt, nicht auf die einzelnen dort zusammengefassten Politiken. Damit fallen jedoch Policy-Phasen und Agenda-Phasen auseinander.
So ist die Arbeitsmarktpolitik im ganzen Beobachtungszeitraum immer schon weiter fortgeschritten als das Reformpaket. Als Phase des Agenda-Setting soll die Zeit bis kurz nach der Agenda-Rede im März 2003 bezeichnet werden. Die Phase der Politikformulierung und Entscheidung umfasst die Zeitspanne vom April 2003 bis zum Herbst desselben Jahres (bis zu den Parteitagen und den Abstimmungen im Deutschen Bundestag zu den Hartz-Gesetzen). Der Umsetzungs- oder Implementationszeitraum beginnt entsprechend im Herbst 2003.
2 Strategiefähige Kernexekutive
2.1 Die Organisation einer Strategie – zur Dimension der Durchsetzungsfähigkeit
Mit dem Umbau der Regierung und der Neubestimmung der Ministeriumszuständigkeiten in der Folge der Koalitionsverhandlungen Ende 2002 erfolgte auch die Bildung eines strategischen Machtzentrums innerhalb der Kernexekutive, das grundsätzlich in der Lage schien, Akteure ressortübergreifend zu vernetzen und den Einfluss bürokratischer Fachbrüderschaften zu schwächen.
Die Abberufung des Bundessozialministers Walter Riester, die Neubildung des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit unter der Führung von Wolfgang Clement als eine Art Superministerium mit Superminister sowie die Besetzung des ebenfalls neu gebildeten Ministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung unter Ulla Schmidt schufen eine neue Konstellation im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Die Kontinuität im Bundeskanzleramt sicherte Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier, der bereits die Vorarbeiten zur Agenda 2010 geleitet hatte.
Die traditionelle Sozialpolitik konnte in ihrer Bedeutung durch die Überführung wesentlicher Abteilungen in das neue Ministerium für Wirtschaft und Arbeit stärker kontrolliert und integriert werden. Die arbeitsmarktpolitischen Reformen ließen sich in Clements Ministerium nun mit wirtschaftspolitischen Konzepten in einem organisatorischen Gesamtrahmen planen und gesetzgeberisch auf den Weg bringen.
Durch die Arbeit von Karl-Rudolf Korte und Manuel Fröhlich (2004; vgl. auch Korte 2007) besitzen wir relativ genaue Kenntnisse der politischen Abläufe im Vorfeld der Agenda-Rede des Bundeskanzlers: Bereits vor den Wahlen 2002 war in einer Planungsgruppe im Bundeskanzleramt unter der Leitung von Kanzleramtsminister Steinmeier ein Plan zur Umsteuerung der Wirtschafts- und Sozialpolitik entstanden.
Nach der Erstellung eines Strategiepapiers im Kanzleramt, das jedoch für die Koalitionsverhandlungen noch nicht relevant wurde, liefen die Planungen unter dem Titel »Strategie 2010« weiter. Neben dem Kanzleramt waren in diesem Bereich weitere Personen aktiv, die als »Gruppe 2010« zu Planungstagungen zusammenkamen. Der Ausschluss des Sozialministeriums aus der Tagungsrunde im Februar 2003 zeigt zugleich, dass diese Gruppe nicht auf Integration ausgerichtet war, sondern die Profilierung eines bestimmten Politikansatzes vorantreiben sollte.
Die Kerngruppe um Steinmeier, Schröder und Clement, ergänzt um Béla Anda, Thomas Steg, Sigrid Krampitz und Reinhard Hesse sowie Bernd Pfaffenbach und Günther Horzetzky aus dem Bundeskanzleramt, besaß aufgrund dieser Exklusionspolitik nur wenige Verflechtungen und Verbindungen mit anderen zentralen Gruppen in Partei und Regierung. So waren die Grünen als Regierungspartner offensichtlich nicht in der strategischen Kernexekutive vertreten – jedenfalls nicht über eine bei allen zentralen Prozessen anwesende Person oder Personengruppe.
Der Grünen-Beitrag dürfte sich also auf eher punktuelle und bilaterale Kontakte (Schröder – Fischer, Steinmeier – Fraktionsführung der Grünen etc.) beschränkt haben. Auch die sozialdemokratische Partei und Fraktion spielten keine tragende Rolle in der Kerngruppe der Agenda-2010-Betreiber. So ist zu fragen, ob nicht ein zu kleines strategisches Machtzentrum gebildet worden war, das zu wenig Integrationskraft für jene Akteure besaß, die für das Gelingen und die Durchsetzung der Reformen erforderlich waren.
Wenn man Strategien als Ausdruck der Handlungsfähigkeit kollektiver Akteure versteht, ist zu fragen, ob es im Zuge der Agenda 2010 überhaupt zur Ausbildung eines derartigen kollektiven Akteurs und damit eines kollektiven strategischen Machtzentrums gekommen ist. Die individuellen Handlungsschritte von Partei- oder Regierungsmitgliedern müssen so ausgerichtet sein, dass Partei oder Regierung die zentrale Bezugsgröße darstellen und sich Kalkulationen von Nutzen, Kosten, Gewinnen und Verlusten auf diese Einheit ausrichten.
Geschieht dies nicht, herrscht also keine Ausrichtung der Handlungen an einer überindividuellen Einheit, kann diese Einheit auch nicht als strategischer Akteur fungieren. Es muss Führungspersonen gelingen, ein derart hohes Maß an Ausrichtung auf eine kollektive Größe zu erreichen, dass diese als Bezugspunkt aller Strategien erscheint. Erst dann ist die Strategiefähigkeit einer Kerngruppe gegeben.
Es kann durchaus angenommen werden, dass die Konstitution einer derartigen kollektiven Größe als Bezugspunkt für Strategien im Umfeld der Agenda 2010 nicht gelungen ist. Die eigene Partei bildete nicht die Bezugseinheit des politischen Handelns der führenden Personen um Bundeskanzler Schröder. Die sozialdemokratische Partei galt im Gegenteil weithin als eine Gefahr für die Agenda 2010 und musste entsprechend ins strategische Kalkül einbezogen werden. Sie wurde bewusst nicht ›mitgenommen‹, nicht ›integriert‹ oder ›beteiligt‹. Da größere Teile der Partei als widerständig galten, war die Partei ein außerhalb der eigenen strategischen Zurechnungseinheit stehender Akteur in der Umwelt, dessen Folgebereitschaft immer höchst problematisch schien.
Wenn nicht die Partei die Bezugsgröße strategischen Handelns bildete, dann vielleicht die Regierung? Bei den Grünen, namentlich bei Außenminister Joschka Fischer, galt Regierung und Erhalt der Regierungsbeteiligung tatsächlich als höchstes Gut. In Schröders Umfeld ist die rot-grüne Regierung dagegen kein zentraler Bezugspunkt, wohl aber die Führung einer Regierung durch die SPD und einen Kanzler Schröder. Die grüne Regierungsbeteiligung musste aus dieser Sicht nicht als besonderes Gut beachtet und bewahrt werden. Auch die Grünen waren daher im Kalkül des Reformkerns als Umwelt anzusehen.
Wenn aber Partei und Regierung als Bezugspunkte ausfallen, bleiben nur wenige Möglichkeiten der Entwicklung von Strategiefähigkeit. Von einer bloß individuellen Strategie abgesehen kann noch mit einer Parteiströmung als Bezugseinheit allen strategischen Handelns gerechnet werden. Eine weitere Deutung, für die es auch Anhaltspunkte in den öffentlichen Äußerungen der Führungspersonen gibt, lautet, die Bezugseinheit sei ›Deutschland‹, ›das eigene Land‹. Damit wird Strategie jedoch allein auf den internationalen Vergleich verwiesen, während die innernationalstaatlichen Politikprozesse sozusagen strategisch neutralisiert oder ignoriert werden. Es handelt sich also eher um eine Verlagerung oder Verdrängung des Strategischen.
Wenn es nicht ohnehin nur eine Variante der Gemeinwohlrhetorik darstellen sollte, fehlt es doch völlig an einer Rechtfertigung dafür, dass sich eine kleine Akteursgruppe als legitimer Inhaber des nationalen Interesses verstehen darf. Die Memoiren von Gerhard Schröder (2007) zeigen ebenso wie die Erinnerungen von Joschka Fischer (2007) den Vorrang der innerparteilichen Auseinandersetzung als zentraler Konfliktlinie. Der Sieg gegen die innerparteilichen Kritiker war die wichtigste machtpolitische Zielsetzung. Das gilt unabhängig von der Antwort auf die Frage, ob sachpolitische Erwägungen oder persönliche Ambitionen Grundlage der eigenen Positionierung waren.
Während der Entwicklung der Agenda-Politik wie auch später bei ihrer Durchsetzung bestand das Konfliktfrühwarnsystem der strategiefähigen Kernexekutive vorrangig darin, die öffentliche Stimmungslage permanent beobachten zu lassen. Dabei griff man auf die traditionellen Instrumente der Demoskopie zurück. Entsprechende Untersuchungen wurden insbesondere vom Bundespresseamt in Auftrag gegeben.
Direkten Zugang zum strategischen Machtzentrum hatte jedoch mit Manfred Güllner (Forsa) ein einzelner Meinungsforscher, der die Datenproduktion und -präsentation mit einer höchst eigenen Interpretation dieser Daten verband (vgl. Raschke und Tils 2007: 512). Man kann hier durchaus auf den Terminus des politisch-strategisch agierenden Meinungsforschers verfallen, der selbst eine Strategie entwickelt und im Machtzentrum zu verankern sucht. Die Problematik liegt hier darin, dass im Machtzentrum keine hinreichende Pluralität der Datenpräsentation und Dateninterpretation sichergestellt wurde und zudem der Beratungs- oder politische Mitakteurscharakter der Beiträge der Meinungsforschung nicht hinreichend reflektiert wurde.
Die Entscheidung für die Agenda 2010 bedeutete auch eine Entscheidung für ein bestimmtes Kräfteverhältnis innerhalb der Kernexekutive. Im Bereich der Regierungsorganisation sollte die Agenda das Element der Kanzlerdemokratie gegenüber der Ressortverantwortung stärken. Noch mehr gilt die Agenda jedoch als Versuch, den Vorrang der Kanzlerschaft gegenüber der Parteien- und Koalitionsdemokratie zu sichern.
Weder die eigene Partei noch der Koalitionspartner bildeten die zentralen Bezugspunkte des politischen Prozesses ab März 2003. Die Chance, die Politik im Rahmen der Koalitionsdemokratie zu prägen, wurde bereits im Oktober 2002 mit weithin als missglückt bewerteten Koalitionsverhandlungen verspielt. Wie bereits 1998 versuchte Gerhard Schröder auch 2002 nicht, auf die Koalitionsgespräche Einfluss zu nehmen. Er ließ diese vielmehr weitgehend ›laufen‹, mit dem Effekt einer von den Beteiligten im Nachhinein als katastrophal bezeichneten Wirkung: Es kam zu einer weitgehend kopflosen und medial kolportierten Debatte über Kürzungs- und Sparprogramme angesichts einer ›plötzlich‹ sichtbar gewordenen Finanz- und Haushaltslage, die im Wahlkampf weitgehend ausgeklammert worden war, den handelnden Akteuren jedoch durchaus bewusst gewesen sein musste.
Die Möglichkeit von Einschnitten in das soziale Sicherungssystem sowie die Möglichkeit zu einer Rhetorik der harten Maßnahmen bestand damit durchaus schon im Herbst 2002. Die Koalitionspolitik wurde jedoch nicht genutzt, um konzeptionell oder auch nur politisch-rhetorisch zu Fortschritten zu kommen. So gilt die Agenda2010-Rede als zweite, nachgeholte Regierungserklärung nach der verspielten Chance des Regierungsstarts im Oktober 2002.
Zwar ist es richtig, dass sich die ökonomische Lage in den Monaten Oktober 2002 bis März 2003 weiter verschlechterte, doch die Basisdaten waren Ende 2002 schon bekannt bzw. ersichtlich. So ist nicht wirklich verständlich, warum die Möglichkeiten der Koalitionsdemokratie derart ungenutzt blieben. Umso größer musste Anfang 2003 die Anstrengung ausfallen, den Kanzler zum zentralen Anker des gesamten politischen Entscheidungsprozesses zu machen und nachzuholen, was in den Koalitionsgesprächen verpasst worden war.
Jedoch kann ein solch projektierter Vorrang der Kanzler- vor der Parteien- und Koalitionsdemokratie nur gelingen, wenn sich Verbündete für diese Vorherrschaft finden lassen. Dabei ist in erster Linie an die Erfordernisse des Föderalismus zu denken. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat konnten die zentralen Reformvorhaben faktisch nur mit Zustimmung der Union durchgesetzt werden. Die rot-grüne Koalition betrieb entsprechend oft eine perspektivisch auf einen großkoalitionären Konsens ausgerichtete Politik.
Jedoch besaß die Union immer die »Lafontaine-Option« der Nicht-Kooperation und Blockadepolitik im Bundesrat. Verhandeln hieß mithin, einerseits Druck aufzubauen und andererseits der Union so weit entgegenzukommen, dass diese sich den Verhandlungen nicht mehr durch eine konsequente parteipolitische Strategie der Blockade entziehen konnte. Damit überhaupt Aussicht auf politische Erfolge bestand, musste die parteipolitische Arena nicht nur in der eigenen Koalition geschwächt werden, sondern auch in der Union. Konsequente Ausschaltung des Parteipolitischen zum Zwecke des Parteienkonsenses schien mithin die implizite Maxime des strategischen Handelns zu sein.
Dagegen wurden die Interessenverbände als gegnerisches Feld betrachtet und absichtlich nicht berücksichtigt. Entsprechende negative Reaktionen der Verbände sind gut dokumentiert (Weßels 2007).
2.2 Strategiefähigkeit und Mediendemokratie – zur Dimension der Kommunikation
Die Strategie der Dominanz des Kanzlers innerhalb der Kernexekutive erhöhte die Bedeutung der Medien. Erst durch die Absicherung der Kanzlermacht in einer quasi-direktdemokratischen Legitimation durch die Öffentlichkeit schien die Machtbeschränkung von Parteien, Fraktionen und Fachbürokratien im erforderlichen Maße erreichbar (vgl. Grasselt und Korte 2007: 161). Damit spielte die Kommunikationsdimension für die strategischen Möglichkeiten der Kernexekutive im Rahmen der Agenda 2010 eine besondere Rolle.
Ganz zentral wäre in dieser Hinsicht die Stärkung der Kommunikationskapazitäten gewesen. Die institutionellen Voraussetzungen für kohärente politische Kommunikation hatten sich mit dem Leitungswechsel im Bundespresseamt 2002 allerdings eher verschlechtert, wurde doch nun mehr auf kostenträchtige externe Partner gesetzt als auf eine intern gesteuerte Kommunikation aus einem Guss. Mit dem Einsatz großer Medienkampagnen traditioneller Art ging auch der Verzicht auf dialogorientierte Kommunikationsmethoden und Beteiligungsformate einher.
Die bemerkenswerteste Entwicklung des gesamten Agenda-2010Prozesses spielte sich jedoch im Bereich der Abstimmung der Kommunikation ab. Denn der Diskurs wurde allein auf die Massenmedien abgestimmt, nicht aber auf die Alltagskommunikation der Bürger. Gerade bei den Themen der Agenda 2010 war jedoch eine enorme Auseinanderentwicklung zwischen veröffentlichter medialer Meinung und öffentlicher Meinung, wie sie sich in Umfragen und Wahlergebnissen niederschlägt, zu beobachten.
Die Agenda 2010 als Ansatz, die Reformblockade zu durchbrechen und die wirtschaftliche und politische Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland wiederherzustellen, fand durchaus große politische Zustimmung in den Leitmedien. Die veröffentlichte Meinung 2003 kann als neoliberal und reformfreundlich bezeichnet werden. Und doch begleitete diese mediale Unterstützung der Reformen ein gewisses Erschrecken über deren Folgen – zum Teil auch in den Medien, weit stärker jedoch in der Alltagskommunikation der Bürger.
Die Annahme, man könne sich auf eine Abstimmung mit den Medien stützen und im Einklang eines strategischen Machtzentrums mit der medialen Öffentlichkeit intermediäre Instanzen umgehen, erwies sich letztlich als verfehlt. Neben den Massenmedien wirkte die Alltagskommunikation – die Ebene der Face-to-Face-Kommunikation der Bürger – als politisch mächtige Instanz: Es waren ihre fest ausgeprägten Überzeugungen und Einstellungen, die selbst durch hegemoniale Mediendiskurse und Willensbekundungen der politischen Eliten nicht in eine bestimmte Richtung gesteuert werden konnten.
Die Alltagskommunikation verfügt über eine gewisse Eigendynamik und versteht es, sich in bestimmten Fällen gegen alle Einflüsse abzuschotten. So abrupt, wie sich die Alltagskommunikation manchmal medialen Meinungsprägungen anschließt, so fest verschlossen mag sie in anderen Fällen der medialen Formung entgegenzustehen. Ohne diese Ebene der artikulierten Bürgermeinungen jenseits der Massenmedien wäre nicht zu erklären, wie es zu dem permanenten Vertrauensverlust der SPD, ihren Wahlniederlagen, den Demonstrationen gegen die Hartz-IV-Politik und zum Akzeptanzmangel der Agenda-2010-Politik gekommen ist. Gerade auf der Ebene der politischen Kommunikation, jener Arena, in der sich Bundeskanzler Gerhard Schröder besonders wohl zu fühlen glaubte, versagte die Agenda-Politik – manche Beobachter sprechen sogar von einer Katastrophe (Raschke und Tils 2007: 522).
2.3 Strategieentwicklung und Expertise – zur Dimension der Kompetenz
Mit der Proklamation der Agenda 2010 wurde auch der Prozess der Kommissionsbildung und der verstärkten Einbeziehung der Wissenschaft in die Politikformulierung gestoppt. Zwar wirkten hier die bereits einbezogenen Akteure weiter mit und das Jahr 2003 kann durchaus als Jahr der Experten(kämpfe) angesehen werden, doch lag die Einsetzung insbesondere der Hartz- und auch der Rürup-Kommission vor der Entwicklung der Agenda-Politik. Diese war weniger als ihre Vorgängerpolitiken auf Einbindung, Beteiligung und Konsensbildung ausgerichtet und verzichtete daher auch darauf, das strategische Know-how der Reformakteure durch Einbindung externer wissenschaftlicher Expertise in Planungs- und Foresight-Einheiten zu stärken.
Auch die Schaffung neuer institutioneller Voraussetzungen für effektives Ausschöpfen interner Expertise gehörte nicht mehr zum Programm der Regierungspolitik. Denn die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen der Ministerien gestaltete sich 2003 durchaus nicht konfliktfrei. Während das Kanzleramt die HartzKommission weitgehend in Eigenregie betreiben konnte, blieb die Rürup-Kommission in der Obhut des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung mit entsprechenden Friktionen zwischen Kanzleramt und Ministeriumsspitze.
Das strategische Machtzentrum war nicht so zusammengesetzt, dass eine Zusammenarbeit mit der Verwaltung oder eine Steuerung derselben leicht zu organisieren war. Es fehlte ein Ausbau der personellen Kapazitäten und Kompetenzen direkt bei der Kerngruppe. Angesichts der hohen Zahl von Agenda-Gesetzen war eine enge Vernetzung der Planungs- und Grundsatzstäbe in den beteiligten Ressorts gar nicht oder nur begrenzt zu bewerkstelligen. Zudem spricht die Tatsache, dass die plötzlich in der Agenda zusammengefassten Gesetzgebungen sich in jeweils höchst unterschiedlichen Stadien der Vorbereitung bzw. Entscheidung befanden, für die Unmöglichkeit einer Vorabstimmung über die Stabsabteilungen der Ministerien.
Die hohe Streubreite der Agenda-Materien lässt es auch nicht zu, speziell für die Agenda eine Ausbildung und Rekrutierung qualifizierten Führungspersonals mit hoher interdisziplinärer Offenheit vorzunehmen. Ein spezifischer Agenda-Führungsstab, der langfristig aufgebaut und zu diesem Zweck rekrutiert worden wäre und der personelle Kompetenzen und Leadership-Fähigkeiten im strategischen Machtzentrum gebündelt hätte, existierte nicht.
3 Agenda-Setting
3.1 Die Agenda 2010 als Konfliktstrategie – zur Dimension der Durchsetzungsfähigkeit
In der Vorbereitung der Agenda 2010 wurde ohne Zweifel ein Prozess in Gang gesetzt, der auf die Bestimmung von politischen Profilierungschancen ausgerichtet war. Bereits während der ersten Regierungsperiode von 1998 bis 2002 war die veröffentlichte Meinung von der Forderung nach weiteren Reformen, nach Überwindung der Reformblockaden und nach einem Umbau des Sozialstaates geprägt. Die politischen Profilierungschancen bestanden immer weniger darin, sich für die tradierten programmatischen Überlegungen der eigenen Parteien einzusetzen, sondern darin, wider deren Aussagen eine Wende in Richtung veröffentlichter Meinung vorzunehmen.
Jedoch bleibt fraglich, ob das Gelegenheitsfenster richtig identifiziert und die Durchsetzungschancen umfassend bewertet wurden. Sicherlich resultierte der Strategiewechsel 2002/03 aus der Erkenntnis, dass sich die wirtschaftliche Lage entgegen den Anfang 2002 noch gehegten und bis in den Wahlkampf weiter verbreiteten Erwartungen verschlechtern statt verbessern würde. Damit war eine Politik ohne Mitwirkung der Union nicht mehr möglich. Auch das schlechte Funktionieren des Bündnisses für Arbeit dürfte den Beteiligten klar gewesen sein.
Die interessante Frage ist jedoch, wie sie die Durchsetzungschancen innerhalb der SPD und die Bedeutung eines Kurswechsels in Richtung einer Konfrontation mit den Gewerkschaften einschätzten. Es kann hier nur vermutet werden, dass innerparteiliche Konfliktkonstellationen nicht nur beobachtend und abwägend, sondern durchaus in teilnehmender, mithin positionierter Perspektive wahrgenommen und beurteilt wurden. Daraus mag folgen, dass man die Konsequenzen insbesondere der Arbeitsmarktreformen für die Mitgliedschaft der Partei (und nicht nur für die linken Parteieliten) unterschätzte. Die Möglichkeit der Bildung einer auch in Westdeutschland starken Partei links von der SPD war anscheinend nicht antizipiert worden, während Austritte einzelner Personen und Gruppen vielleicht durchaus in Kauf genommen wurden.
Jedoch ist die dauerhafte Absenkung des Niveaus der Wählerzustimmung zur eigenen Partei ein Ergebnis der Agenda-Politik, das bei der Abwägung aller Vor- und Nachteile hätte antizipiert und auf jeden Fall vermieden werden müssen. Zwar wurde in der Regierungserklärung bereits darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen der Agenda 2010 nicht sofort wirken würden, doch die politisch-strategischen Folgen wurden offenbar nicht hinreichend bedacht.
Wie sollte man diese Durststrecke überstehen, wie der potenziell schwindenden Zustimmung zur Regierungspolitik und den Regierungsparteien während dieser Phase entgegenwirken? Eine nüchterne Betrachtung hätte hier postulieren können, dass es kompensatorischer Politiken bedurft hätte, um die eher negativen Auswirkungen der Agenda 2010 auf die politische Zustimmung in einer Übergangszeit auszugleichen. Für Überlegungen zu derartigen Ausgleichspolitiken in anderen thematischen Feldern finden sich in der AgendaRede ebenso wenig Anhaltspunkte wie in der nachfolgenden Regierungspolitik des Jahres 2003, die in der Durchsetzung der Agenda weitgehend aufgeht.
Erst Anfang 2004 wurde die Reformpolitik einerseits verlangsamt (Verschiebung einer großen Pflegeversicherungsreform) und andererseits kombiniert mit Innovationsthemen (Eliteuniversitäten). Der Versuch, durch eine Ausbildungsabgabe ein eher kompensierendes Element in die Reformpolitik einzubauen, kam nicht aus der Regierung, sondern aus der Partei und scheiterte im Bundesrat bzw. wurde durch die Selbstverpflichtung der Wirtschaft im Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs als hinfällig angesehen (Schmid 2007: 283; Zohlnhöfer und Egle 2007: 17). Eine Unterschätzung dieser Zustimmungsproblematik mag dadurch bedingt gewesen sein, dass man die Länge der Durststrecke zu optimistisch einschätzte oder darauf vertraute, dass die Agenda-Politik populär werden könnte – auch wenn die Interessenvertreter und die eigene Partei sich eher skeptisch bis ablehnend verhalten würden. Zum Agenda-Setting ist auch die Aufgabe zu zählen, Verhandlungskorridore für die Reformpolitik abzustecken. Die dazu erforderliche Sondierung der Interessen und Positionen von Schlüsselentscheidern inner- und außerhalb des eigenen politischen Lagers gehört zur täglichen Arbeit der politischen Eliten. Bei der Vorbereitung der Agenda-Rede kam es sicherlich zu einer solchen Interessensondierung. Sie bestand jedoch ausschließlich in einer Beobachtung der anderen Akteure und nicht in einer Einbeziehung aller relevanten Personen in den Prozess.
Da Gegnerschaften bereits bekannt waren, hieß Sondierung zunächst nur, eine Differenzierung nach Unterstützern und Gegnern des möglichen Vorhabens vorzunehmen, nicht aber unbedingt, auch eine Reformperspektive vorzulegen, die die Anzahl der Gegner minimiert und die der Unterstützer möglichst erweitert. Die sorgfältige Analyse der Machtkonstellation mit Identifizierung der Reformbefürworter und Antizipation von Widerständen führte in der AgendaPolitik zur Anlage der Reformprozesse als Konfliktstrategie. Da Widerstände in der SPD-Fraktion, in der Partei und in den Gewerkschaften sicher unterstellt werden konnten, prägte diese erwartete Konfliktkonstellation das prozessuale, kommunikative und inhaltliche Profil der Reformen.
3.2 Ohne Leitidee – zur Dimension der Kommunikation
Analysiert man die »Agenda 2010« als politische Marke, als politisches Werbeinstrument, fällt zunächst die Nutzung des wenig aussagehaltigen Wortes Agenda auf. Selbst ein Begriff der Politik- und Kommunikationswissenschaft, enthält Agenda keine Aussage zur Richtung, zum Inhalt oder zum normativen Gehalt der angestrebten Politik. Die Technizität der Reformvokabeln wurde bereits vielfach bemerkt und gescholten: Weder »Hartz I bis IV« noch »SLG II« oder »ALG I und II« noch »Agenda 2010« besitzen als Begriffe eine innere Werthaltigkeit. Der Terminus Agenda kommuniziert gerade keine Leitidee und ist deshalb auch nicht darauf gerichtet, die Reformbereitschaft zu fördern.
In den Erinnerungen Schröders findet sich eine Formulierung, die das kommunikative Dilemma unfreiwillig zu erkennen gibt. Dort wird von der Suche nach einer »Begründung für die Reformnotwendigkeiten« gesprochen (Schröder 2007: 392). Die Notwendigkeit stand ganz im Zentrum der Argumentationsstrategie der Bundesregierung. Nur fehlte es offensichtlich an jedem Verständnis dafür, dass es neben der Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen und Anpassungen auch immer noch der Notwendigkeit – und das heißt vollkommene Alternativlosigkeit – genau dieser und keiner anderen Reformmaßnahmen bedurft hätte.
So erzeugte die Agenda mit ihrem Verweis auf das zwingend Erforderliche immer eine Argumentationslücke. Reformspielräume wurden als nicht existent definiert, obwohl die konkreten Reformen in komplizierten, konfliktreichen und schließlich von Kompromissen getragenen Verfahren – und damit durchaus mit einem hohen Grad an Kontingenz versehen – entschieden wurden. So erschien es oft, als herrsche in der Regierungsspitze völliges Unverständnis dafür, dass eine Politik, die sich als Anpassung an veränderte Realitäten versteht, einer Wertbasis bedarf und sich als notwendig, richtig und wertvoll ausweisen muss. Das Notwendige schien speziell bei Gerhard Schröder immer auch das Wertvolle zu sein.
Dieser Verzicht auf eine explizite Wertbindung ging einher mit zwei anderen Verzichtsleistungen: zum einen mit dem Ausschluss einer ideologischen Rahmung der Agenda-Politik mit zumindest vagen Ausblicken auf ideale Konzepte oder idealisierte Zukunftsbilder. Die Überlegungen, die Leitideen »Gemeinsinn« und »Zivilgesellschaft« zu nutzen (Korte und Fröhlich 2004: 298), wurden von Bundeskanzler Schröder abgelehnt – als ihm nicht gemäß. Ob gerade diese Begriffe tragfähig gewesen wären, eine neue Arbeitsmarktpolitik und einen Sozialstaatsumbau zu rechtfertigen, kann durchaus bezweifelt werden.
Zum anderen fehlte es auch an einer kognitiv-explanatorischen Rahmung, einer geduldigen Erklärung der Mechanismen der Weltwirtschaft, die Deutschland in die gegenwärtige Situation gebracht haben. Obwohl die Agenda-Politik in der Kontinuität zum BlairSchröder-Papier steht (Schröder 2007: 276), sind doch der überhöhende Charakter der Programmatik sowie die Rechtfertigung des Vorgeschlagenen im Blair-Schröder-Papier (Schröder und Blair 1999) weit ausgefeilter.
Die Agenda-Politik wurde schließlich auch nicht mit neuen Deutungsmustern, Metaphern oder Denkfiguren verbunden. So konnte sie als »nahezu begründungslos« erscheinen (Meyer 2007: 88), auch wenn es Begründungssätze aus dem bekannten Wortfeld wirtschaftspolitischen Denkens gab, die in der März-Rede die Maßnahmenkataloge zu den einzelnen Politikbereichen miteinander verbanden. Der Ausdruck Agenda steht also ohne weitere Kontextualisierung und Absicherung durch andere Begrifflichkeiten im Raum. Zwischen ihm und den einzelnen Politiken gibt es keine extra etablierten Bindebegrifflichkeiten. Ebenso – und das ist für Politikkommunikation auf diesem Niveau bemerkenswert – fehlt es an Metaphoriken, die später für die Visualisierung des Gesagten genutzt werden könnten. Selbst das Wort »Dach«, das sich bei der Zusammenführung derart vieler Politiken geradezu aufdrängt und zudem Erweiterungen z. B. in Richtung »Säulen« nahelegt, wurde nicht genutzt.
Die Agenda-Strategie betonte die Notwendigkeit der Reformen. Sie konnte dabei auch auf eine durchaus hegemoniale Befürwortung weiterer Reformen in der medialen Öffentlichkeit vertrauen. Aber auch wenn so Problembewusstsein in der Öffentlichkeit geschaffen und ein mediales Grundrauschen bereits erzeugt war, gelang es doch nicht, die Reformnotwendigkeit zu erklären. Eine Erklärung hätte zum Beispiel eine Politik des geduldigen Überzeugens durch permanente Darstellung der ökonomischen Zusammenhänge und damit eine Aufklärungsstrategie erfordert. Ein derartiger Gestus passte jedoch sicherlich nicht besonders gut zu den Hauptakteuren.
Alternativ wäre die Konzentration auf eine zentrale Erzähllinie möglich gewesen. Das entsprechende Narrativ war jedoch nicht hinreichend expliziert und pointiert, zudem immer nur als Negativstory des wirtschaftlichen Abstiegs der Bundesrepublik gerahmt. Es konnte nicht als gute Geschichte erzählt werden, wie etwa das Narrativ des Wirtschaftswunders. Auch enthielt es implizit Schuldzuweisungen, was die Neutralität dieser Erzählung in Frage stellte.
Während die ökonomischen Kausalzusammenhänge nicht erfolgreich zu einem politischen Narrativ verdichtet werden konnten, lässt sich für die demographische Thematik das Gegenteil behaupten. Hier setzte sich sehr erfolgreich die Story der Alterung der Gesellschaft als Folge niedriger Geburtenraten durch. Auch in dieser Geschichte gibt es implizite Schuldzuweisungen, auch sie ist eher Konflikt erzeugend (jung gegen alt) als vermeidend. Und doch erhält sie durch Mathematisierungen wie den Altenquotienten und die Entwicklung des Beitragszahler/Rentner-Verhältnisses etwas von einer Zwangsläufigkeit, die den ökonomischen Erzählungen so nicht entsprach. Letztlich spielte die demographische Thematik in der Agenda-Politik nicht die zentrale Rolle, da sie zwar mit Renten- und Gesundheitspolitik gut zu verknüpfen war, weniger jedoch mit der Arbeitsmarktpolitik.
3.3 Defizite in der Situationseinschätzung – zur Dimension der Kompetenz
Die Identifikation des Reformbedarfs, die Analyse des Problemumfeldes und die Klärung der generellen Reformrichtung als zentrale Aufgaben in der Phase des Agenda-Setting waren auf der Ebene der Einzelpolitiken bereits weit vor der Agenda-2010-Rede erfolgt. Die Zukunftsthemen waren schon seit langem identifiziert und die Probleme erkannt. Die Inflexibilität des deutschen Arbeitsmarktes, das hohe Lohnniveau sowie die zu hohe Belastung mit Lohnnebenkosten galten als zentrale Problemverursacher der hohen und dauerhaften Arbeitslosigkeit.
Die Arbeitsmarktpolitik war eines jener Politikfelder, in dem die rot-grüne Koalition gezielt nach internationalen Best Practices gesucht hatte. So sind insbesondere die Arbeiten der BenchmarkingGruppe des Bündnisses für Arbeit zu nennen, die unter Beteiligung von Wolfgang Streeck, Rolf Heinze, Günther Schmid, Gerhard Fels und Heide Pfarr in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung systematische Auswertungen der Politikentwicklungen in den OECDLändern enthalten.
In der Hartz-Kommission erfolgte insbesondere auf der Basis der Arbeiten von Günther Schmid und Werner Jann ein ähnlicher Abgleich der arbeitsmarktpolitischen Reformen in den Bereichen Vermittlung und Aktivierung sowie der generellen Entwicklung der Verwaltungsmodernisierung mit wichtigen europäischen Reformländern. Eine analoge Sondierung der Reformen in anderen Ländern gab es allerdings (vom Fall der Schweiz als Vergleichsland in der Beurteilung von Kopfpauschalen) in der Rürup-Kommission für die Sozialversicherungen nicht.
Ein Vergleich der Gesamtanlage einer reformorientierten Regierungspolitik und der Möglichkeiten, Reformen in einem Programm zu bündeln, scheint eher nachträglich erfolgt zu sein (Merkel et al. 2006), sieht man von der generellen Orientierung der Regierungspolitik am englischen Beispiel und von Tony Blairs Führungsstil ab.
Auch die Problemumfeldanalyse mit ihren Elementen der Beschreibung und Prognose kann nicht als vernachlässigt gelten. So waren zur Arbeitsmarktentwicklung bereits eine Fülle von wissenschaftlichen Ursache-Wirkungs-Analysen vorgelegt worden, die auch den politischen Entscheidungsprozess erreichten. Doch dominierte in den Vor-Agenda-2010-Prozessen eine der in der Wissenschaft vertretenen Sichten: die Interpretation der Arbeitsmarktprobleme als Kombination aus einem Niveau- und einem Flexibilitätsproblem.
Alternative Deutungen der wirtschaftlichen Probleme wurden als gegnerische und nicht zutreffende Aussagen wahrgenommen, nicht als einzubeziehende Ansichten. Da sich die Ursache-Wirkungs-Analysen in der Wissenschaft direkt widersprachen, ist dieser selektive Zugriff auf eine wissenschaftliche Interpretation fast zwingend, bestenfalls wäre eine verstärkte Suche nach Kombinationen zwischen den von den verschiedenen Theorien angebotenen Reformrezepten anzumahnen.
Eine sorgfältige Stakeholder-Analyse als Teil der Problemanalyse durchzuführen, hätte Anfang 2003 beinhaltet, die Gründe für das Scheitern des Bündnisses für Arbeit durch die Nicht-Einigungsfähigkeit von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften als Ausdruck von Interessenlagen und situativen Bedingungen auf Seiten der verschiedenen Stakeholder zu ermitteln. In die damalige Situationseinschätzung mischte sich jedoch, so darf man den öffentlichen Äußerungen der Reformakteure wohl entnehmen, eine Schuldzuweisung an reformunwillige, intransigente Gewerkschaften, uneinsichtige, Illusionen nachhängende Genossen in der eigenen Partei und die Pflege alter Gegnerschaften. Die Stakeholder-Analyse schlug daher von einer Situationsanalyse in eine durchaus emotional geprägte Gegneridentifikation um.
Man kann davon ausgehen, dass der Entwicklung der AgendaPolitik insgesamt keine politisch-strategischen Prognosen in systematisierter Form zugrunde lagen. Wohl war die Agenda 2010 als Befreiungsschlag geplant, doch wurden keine Szenario-Techniken zur Nachhaltigkeit der Wirkungen einer derartigen Politik angewandt. Auch eine systematische Risikoabschätzung, sei es in politischer, finanzieller oder arbeitsmarktpolitischer Richtung, ist nicht erfolgt.
Die politische Entscheidungsfindung wurde daher von eher intuitiven Einschätzungen der Kräfteverhältnisse, der möglichen nichtintendierten Folgen und der Erfolgschancen bestimmt. Die Dominanz des Durchsetzungsansatzes und die Einteilung in Gegner oder Befürworter, die sich zur Freund-Feind-Konstellation zuspitzte, ließ Folgenabschätzung in einem beschreibend-prognostischen Sinne auch gar nicht mehr zu. Zu den eher intuitiven Erwartungen mag auch gehört haben, dass eine wirtschaftsfreundliche Politik von den Interessenvertretern der Wirtschaft honoriert werden würde. Diese Spekulation auf Reziprozität seitens der Wirtschaft könnte für die richtungspolitische Anlage der Reformen von Bedeutung gewesen sein, dürfte sich in der erhofften Weise jedoch nicht realisiert haben.
Eines der in der Öffentlichkeit sehr häufig diskutierten Kriterien zur Agenda-Politik ist die Klärung der Reformrichtung. Was ist das Ziel dieser Politik? Lässt sich wirklich alles auf eine Zielsetzung zurückführen? Stehen alle Maßnahmen im Einklang mit dieser Grundkonzeption? Die additive Anlage der März-Rede lässt gerade an der Fokussierung zunächst zweifeln. Immer wieder konnte der Eindruck eines Sammelsuriums entstehen. Doch diese eher formale Kritik einer fehlenden Bündelung aller Teilpolitiken dürfte im Schatten des Zweifels an der Wertfokussierung der Agenda-Politik stehen.
Die Frage, ob die Agenda-Politik eine Fokussierung in Richtung einer Problem- und Leitzieldefinition besaß, kann freilich sehr unterschiedlich beantwortet werden. Erscheint einigen Beobachtern der Verzicht auf Wertvokabeln als der Verlust von Leitzielorientierung, so finden andere in der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ein überaus klar herausgestelltes Ziel.
Die Orientierung an Notwendigkeiten erscheint den einen als Höchstmaß inhaltlicher Fokussierung (»nur diese Maßnahmen versprechen Erfolg«), anderen fehlt eine nicht-ökonomistische Wertfokussierung als – in dieser Sicht – unhintergehbares Element jedes Reformleitbildes. Die Tatsache, dass bis heute der Ausdruck Agenda 2010 für ein weiterhin umstrittenes Programm verwendet wird, vermittelt zumindest nachträglich den Eindruck, dass es sich um eine klare, bewusst gewählte Ausrichtung handelt.
4 Politikformulierung und Entscheidung
4.1 Strategien einer Kürzungspolitik – zur Dimension der Durchsetzungsfähigkeit
Um sich öffentlichen Rückhalt zu sichern und Bündnispartner zu gewinnen, bedarf es vielfältiger Kanäle und Verfahren. Gegenüber wichtigen Fachöffentlichkeiten empfehlen sich andere Vorgehensweisen als gegenüber der massenmedialen Öffentlichkeit. Die parallel zur Formulierung und Umsetzung der Agenda 2010 arbeitende RürupKommission dürfte sicherlich die Funktion gehabt haben, die wirtschaftswissenschaftliche Fachöffentlichkeit weiter zu mobilisieren.
Auch stand der Inhalt der Agenda 2010 durchaus der herrschenden Meinung insbesondere in der Ökonomie näher als die Regierungspolitik in der ersten rot-grünen Legislaturperiode. Andere wissenschaftliche Disziplinen und Fachöffentlichkeiten wurden jedoch nicht durch gesonderte Kommunikationsverfahren einbezogen, sieht man von den Arbeitsmarktexperten ab, die an der unmittelbaren Umsetzung der Hartz-Gesetze und ihrer Evaluierung beteiligt waren.
Bündnispartner auf der Ebene der Verbände und Interessengruppen konnten durchaus gewonnen werden, jedoch nur dort, wo ohnehin eine Bereitschaft für wirtschaftsliberale Politiken gegeben war. Die schwierige Aufgabe der Gewinnung von Unterstützung bei den Organisationen, die bisher eine traditionell sozialdemokratische Sozial- und Wirtschaftspolitik befürwortet hatten, gelang entweder nicht oder nur unter Inkaufnahme innerverbandlicher Konflikte. Bündnispartner wurden daher auf der anderen Seite des politischen Spektrums gewonnen und gegen die bisherigen Unterstützergruppen in Stellung gebracht. Diese Cross-over-Bündnisse verstärkten auf Seiten der Parteimitglieder und vieler ehemaliger Bündnispartner die Irritation über die Regierungspolitik.
Gegenüber der massenmedialen Öffentlichkeit wäre es vor allem darauf angekommen, die Reformen als Win-win-Situation darzustellen. Dies konnte und sollte auch nicht erfüllt werden, weil sich die Agenda als Ablösung einer solchen Win-win-Politik verstand. Sie war gerade als Antipode einer Konsenspolitik, wie sie im Bündnis für Arbeit gescheitert war, angelegt.
Auf längere Sicht schien eine Win-win-Konstellation allerdings möglich: Im Falle eines Konjunkturaufschwungs durch die Einschnitte der Agenda 2010, so die Annahme, würde sich auch die Beschäftigungs- und Einkommenssituation der anfangs negativ Betroffenen verbessern. Dies kann allerdings nicht als Win-win-Konstellation, sondern bestenfalls als Win-win-Horizont gedeutet werden. Eine in unmittelbarer oder naher Zukunft angesiedelte Win-win-Situation wurde dagegen nicht angestrebt und auch nicht versprochen. Allein die Dauer, die zwischen den Einschnitten heute und einem erhöhten Wachstum morgen verstreichen würde, war auslegungsfähig und entsprechend strittig.
Die Alternative zu einer Win-win-Konstellation hätte jedoch auch in einer allseitigen Loss-loss-Politik bestehen können, oft in Anlehnung an Churchills berühmte Rede als Blut-, Schweiß- und TränenPolitik bezeichnet. In einem derartigen Rahmen wären aktuelle Einschränkungen für alle mit einem Win-win-Horizont für alle zu verbinden gewesen. Es gibt durchaus Hinweise, dass eine derartige Strategie aussichtsreich gewesen wäre: Sie hätte die egalitären Impulse der Sozialdemokratie weit besser bedienen können als die Konzeption der Agenda 2010. Diese Strategie wurde jedoch nicht gewählt und wohl auch nicht ernsthaft erwogen.
Die Agenda 2010 verdankt sich nicht zuletzt der deutlichen Dominanz wirtschaftsliberalen Denkens in der veröffentlichten Meinung. Fast permanent wurde die fehlende Reformfähigkeit der Bundesrepublik (oder der rot-grünen Regierung) beklagt, fortwährend wurden politische Instrumente als vorbildlich erörtert, die später in der Agenda auch zur Anwendung kamen. Die Agenda 2010 schien daher in den Diskursrahmen gut eingepasst, sie stellte ein Eingehen auf die medialen Stimmungs- und Argumentationslagen dar und hätte sich so gar nicht mehr um den Aufbau der Diskurshoheit kümmern müssen.
Jedoch waren nach dem Start des Agenda-Reformprozesses zwei Entwicklungen zu beobachten, die einem bloßen Surfen auf der Welle des öffentlichen Diskurses entgegenwirkten. Zum einen wurde die Diskursdominanz durch die Skandalisierung einzelner Elemente der Agenda-Reformen gebrochen, zum anderen stellte sich heraus, dass diese mediale Stimmung keineswegs in der Lage war, die Meinungen in der Bevölkerung und in den Gewerkschaften zu beeinflussen.
Entgegen der Meinungslage in den führenden Medien konnte die Opposition auf Seiten der Gewerkschaften und größerer Teile der SPD durchgehalten werden, getragen von durchaus festen Überzeugungen in der Wählerschaft. Weder Politik noch Medien konnten die existente Diskurshoheit auf die Ebene der individuellen politischen Meinungen und Überzeugungen in der Wählerschaft übertragen. Die Diskurshoheit erwies sich als Eliten- oder Teilgruppenphänomen, nicht als Widerspiegelung einer Mehrheitsmeinung.
Offensichtlich haben sich, das legen zudem die Ergebnisse der Bundestagswahlen 2005 ebenso wie die der vorhergehenden Landtagswahlen nahe, Überzeugungen in der Bevölkerung erhalten, dass zumindest bestimmte Teile der Agenda 2010 nicht akzeptabel seien – sei es aus Betroffenheit und Eigeninteresse oder aus Vorstellungen von Gerechtigkeit und Zumutbarkeit. Der Regierung ist es daher nicht gelungen, in allen Teilen der Öffentlichkeit den erforderlichen Rückhalt zu gewinnen. Der Unterstützung durch Fachöffentlichkeiten und die veröffentlichte Meinung in wichtigen Formaten und Organen der Massenmedien stand sinkendes Vertrauen in der Bevölkerung gegenüber.
4.2 Glaubwürdigkeit und Akzeptanzverlust – zur Dimension der Kommunikation
Politikformulierung und -entscheidung sind in der Kommunikationsdimension daran zu messen, ob und in welchem Maße es gelingt, Vertrauen aufzubauen – in der Bevölkerung und auch bei den Gruppen, die für den Implementationsprozess von Bedeutung sind. Die zentrale Kritik an der Agenda 2010 bezieht sich darauf, dass kein adäquates Framing im Sinne der Rückbindung an eine Botschaft (Grand Message) einschließlich Visualisierung und Emotionalisierung entwickelt wurde.
Die Verantwortlichen fanden keine klare und positive Reformsprache. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Termini »Agenda« und »2010« in sich keine metaphorische Kraft, emotionale Ausstrahlung oder inhärente Werthaltigkeit besitzen. Einen nicht oder sehr schwach metaphorischen Begriff jedoch zu visualisieren, ist nur bei Hinzuziehung eines weiteren Begriffs möglich. Die Neutralität des Begriffs Agenda erlaubt zudem die Verbindung mit positiven wie negativen Konnotationen, während ein Begriff wie »Bündnis« per se eine positive Ausstrahlung besitzt, die erst mühsam umgedeutet werden muss, um als etwas Negatives zu erscheinen.
Am ehesten lässt sich mit »2010« noch eine Grand Message verbinden, die als Erzählung von Abstieg und Wiederaufstieg funktioniert, terminiert mit dem Jahr 2010 als Zeit der wiedergefundenen Stärke. Dieses immer mitgeführte Narrativ der Bundesregierung konnte jedoch durch den recht langen Zeitraum bis 2010 als Vertröstung erscheinen (oder umgedeutet werden) und kontrastierte auch merkwürdig zu der Emphase, mit der die aktuell schlechte Situation als Basis einer Reformnotwendigkeit beschworen wurde. Der erste Teil der Story (Abstieg) erschien daher wesentlich plausibler als die zweite, nicht weiter strukturierte Phase des Wiederaufstiegs.
Zudem gelang es nicht, eine Geschichte zu erzählen, die die notwendige Politik zugleich als sozialdemokratisch ausweisen konnte und die eine parteipolitische Profilierung oder auch nur Identitätsbewahrung hätte bedienen können. »Aber selbst wenn es der SPD gelungen wäre, die von ihr angestoßenen Reformen als notwendig und alternativlos zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme Deutschlands zu begründen, hätte sie gleichzeitig deutlich machen müssen, warum ihre Politik spezifisch sozialdemokratisch ist. Das ist ihr kaum gelungen« (Egle 2006: 196).
Die Notwendigkeitsrhetorik vermittelt eher einen negativen Eindruck des Ausgeliefertseins, eines Bedrängtwerdens und einer gewissen Verzweiflung an den eigenen Möglichkeiten. Da die Maßnahmen auch weithin eher belastenden Charakter hatten, gerieten Notwendigkeit/Zwang und Verlust/Opfer zu den zentralen Interpretationsmustern. Sozialabbau erschien als zentrale Botschaft, da es die Bundesregierung nicht vermochte, die Agenda-Politik selbst auf wenige zu kommunizierende Ziele zuzuspitzen (Haubner 2005: 317; Raschke und Tils 2007: 519). Diese hätten nur durch heroische Überhöhung ins Positive gewendet werden können – ein Versuch dazu fand jedoch nicht statt.
Eine ausgewogene Darstellung mit den Elementen Sicherheit (Was bleibt?) und Wandel (Was verändert sich positiv?) wurde verfehlt oder besser: bewusst nicht angestrebt. Zwar fand sich die Formel der Substanzwahrung des Sozialstaates in der Agenda-Terminologie, doch dominierte in der Rechtfertigung dieses Politikansatzes die Wandeldimension, da es zunächst um den Willen zur Anpassung, zur grundlegenden Reform ging. So wurde die Veränderung des Bestehenden in den Vordergrund geschoben, die Sicherheitsdimension eher vernachlässigt. Als Kampf- statt Integrationskonzept setzte die Agenda 2010 nicht auf Balance und Gleichgewicht als Politikmetaphern, sondern auf die Veränderung in eine Richtung, die mit Verlusten an Sicherheit im Sinne des Gewohnten auf jeden Fall einhergehen musste.
Dagegen wurden Gestaltungswillen und Durchhaltevermögen unter Abkehr von einem Dialogangebot öffentlich wie intern in höchstem Maße demonstriert. In diesem Punkt lag die zentrale Stärke der Agenda-Politik und insbesondere von Bundeskanzler Schröder. Die Agenda 2010 war geradezu die Formel für Durchsetzungsbereitschaft gegen relevante Teile der eigenen Partei, gegen große Teile der Gewerkschaften, gegen den alten und gescheiterten korporatistischen Politikansatz, gegen altlinke sozialpolitische Traditionen. Agenda 2010 war ein Kampfbegriff, niemals eine Integrationsformel.
In dieser Hinsicht verkörperte die Agenda 2010 durchaus glaubwürdige Kommunikation und erzeugte realistische Erwartungen. Anti-Illusionismus, Realismus oder Pragmatismus kennzeichneten die gesamte Agenda-Politik. Und doch wurde trotz aller realistischer Schilderung der akuten Problemlagen der Bundesrepublik in der Darstellung der möglichen Reformwirkungen ein eher hoher Ton angeschlagen, der sich im Widerspruch befand zu den vielfältigen, kleinteiligen Wirkungen, die man den vielen kleinen und größeren Maßnahmen der Agenda zuschreiben muss. Dass sich ein derart viele Maßnahmen umfassendes Programm durch aufeinander abgestimmte Wirkungsketten in positive Effekte umsetzt, ist zumindest nicht unmittelbar plausibel.
Neben diese sachliche Dimension des Erwartungsmanagements tritt eine zeitliche: Wann ist mit den erhofften Wirkungen zu rechnen? Der Titel Agenda 2010 impliziert zunächst einen längeren Zeitraum, ganz im Unterschied zu früheren Ankündigungen zum Abbau der Arbeitslosigkeit. Entsprechend hieß es auch in der MärzRede: Die Strukturreformen der Agenda 2010 »werden Deutschland bis zum Ende des Jahrzehnts bei Wohlstand und Arbeit wieder an die Spitze bringen.« Damit war ein Erwartungshorizont von sieben Jahren aufgespannt, der sich nicht mit dem Bundestagswahlrhythmus deckte. Folglich hätte das Thema Lang- bzw. Mittelfristigkeit des Politikansatzes mit einer Phasenfolge von Reformmaßnahmen verbunden werden können, was jedoch nicht geschehen ist.
4.3 Der Faktor Zeit – zur Dimension der Kompetenz
Während eine kommunikative Taktung des Reformweges nicht erfolgte, bestand durchaus eine klare Vorstellung eines Reformfahrplans, der sich aus der Nutzung strategischer Zeitfenster ergab. Insbesondere wurde die Abfolge von Landtagswahlen beachtet. Während das Jahr 2006 als neues Bundestagswahljahr ohnehin im Zeichen des Wahlkampfes stehen würde, bildete der Mai 2005 mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen einen zentralen Termin und einen Orientierungspunkt der Reformpolitik. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten die Reformmaßnahmen umgesetzt sein, damit eine Wiederwahl der rot-grünen Landesregierung gelingen konnte.
2004 standen zudem Landtagswahlen in Hamburg (Februar), Thüringen (Juni), im Saarland, in Sachsen und in Brandenburg (September) an. Vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai 2005 galt es, auch noch in Schleswig-Holstein einen Landtagswahlkampf zu führen. Folglich blieb nur das Jahr 2003 nach den Landtagswahlen in Niedersachsen und Hessen (Februar) für eine einigermaßen konzentrierte Gesetzgebungspolitik, denn die Wahlen in Bayern (September 2003) waren für die Regierungsparteien ohnehin eher aussichtslos.
Also sollte keine Zeit verloren werden: Was nicht in diesem Jahr geschehen konnte, schien verloren. Entsprechend wurde auf Mehrphasenkonzepte verzichtet. Eine effektive Verschaltung von Einzelschritten im Sinne einer Sequenzierung war entweder schon projektiert (so in der Arbeitsmarktpolitik mit Hartz I bis IV) oder stand angesichts der inhaltlichen Verschaltung über Grenzen von Policys hinweg eher im Hintergrund der Überlegungen.
Eine andere Form der Sequenzierung durch Vorschaltung von Pilotvorhaben ist zwar für die Regierungsperiode von 1998 bis 2005 zu beobachten. Sie ist jedoch nicht prägend für die Agenda-Politik. Sicherlich kann man arbeitsmarktpolitische Reformansätze aus der ersten Legislaturperiode von Rot-Grün als Pilotprojekte zu den Hartz-Reformen begreifen, so insbesondere das Job-AQTIV-Gesetz, das am 1. Januar 2002 in Kraft trat, und das ebenfalls 2002 flächendeckend eingeführte Mainzer-Kombilohn-Modell (Blancke und Schmid 2003: 218). Die aus der Verbindung von Organisations-, Instrumenten- und Strukturreform des Leistungsgeschehens resultierende Komplexität der Hartz-Reformen konnte jedoch nicht annähernd erprobt werden – auch nicht durch eine größere Zahl von Pilotstudien zu einzelnen Modulen des Reformprozesses. So ist in irgendeinem umfassenderen Sinne nicht von Wirksamkeitstests durch Pilotprojekte zu reden.
Die Agenda 2010 wurde zu einem Zeitpunkt entwickelt und präsentiert, da sich die strategischen Handlungsräume für die Bundesregierung entscheidend verengt hatten. Bestimmte strategische Möglichkeiten waren versperrt, einzelne Optionen bereits ohne Erfolg genutzt. Die Sondierung der Handlungsoptionen gehört sicherlich zum Alltagsgeschäft der Regierungs- und Reformpolitik. Jedoch geht sie angesichts erschöpfter oder versperrter Möglichkeiten in den Zugriff auf verbliebene Chancen über. Von Sondierung kann dann immer weniger die Rede sein. Verbliebene Optionen werden zu einer Restkategorie gegenüber dem bereits Erprobten.
Andererseits zählte es zu den in der Öffentlichkeit immer wieder behaupteten Stärken des Bundeskanzlers, in scheinbar ausweglos krisenhaften Momenten neue Chancen zu entdecken. Die Negativinterpretation dieser Verhaltensweise lautet, dass der Regierungschef Prozesse längere Zeit ungesteuert habe laufen gelassen und erst intervenierte, wenn sich die Vorgänge zuspitzten, dann aber gleich mit einem überraschenden Befreiungsschlag.
Dies kann auch als Schwäche gedeutet werden, da keine ständige Sondierung der Handlungsräume erfolgte, sondern lediglich eine situative (Raschke und Tils 2007: 507), punktuelle Reaktion. Daraus resultierten wechselvolle Auf-und-ab-Politiken statt einer klaren, mittelfristig durchzuhaltenden Strategie. Die gesamte Agenda-Politik wird daher oft als »Ausfall aus der Festung«, als »Flucht nach vorn« interpretiert (Baring und Schöllgen 2006: 310), nicht jedoch als Ausdruck eines kontinuierlich betriebenen Politikwechsels.
Diese punktuellen Strategiewahlen bedingten auch, dass es zu keiner kontinuierlichen Bewertung von Lösungsalternativen kam, sei es im Sinne entscheidungsanalytischer Verfahren oder der Untersuchung der Wirksamkeit einer Politik (»Impact Assessments«, Nachhaltigkeitsprüfung bzw. entscheidungsanalytische Stakeholder-Verfahren). Der hohe Grad intuitiven Handelns, des Entscheidens allein aufgrund eigener Anschauungen und in kleiner Runde, der Wille zum überraschenden Coup und zum Machtwort entwerten die Verfahren der kontrollierten Vorprüfung politischer Entscheidungen.
5 Politikumsetzung
5.1 Inklusions- und Exklusionsstrategien – zur Dimension der Durchsetzungsfähigkeit
Durch die Vielzahl der Gesetzgebungsgegenstände, die unter dem Dach Agenda 2010 versammelt wurden, war es schwierig, zu einer zentralisierten Zuständigkeit für die Umsetzung der Agenda zu kommen. Daher hing die Umsetzung der Einzelreformen von den spezifischen Bedingungen im jeweiligen Politikfeld ab. An der Umsetzung der Arbeitsmarktreformen war die Bundesanstalt bzw. später die Bundesagentur für Arbeit führend beteiligt. Insofern ist es von Beginn an gelungen, die entscheidende Einheit der Verwaltung einzubinden.
Das Zeitmanagement der Reform musste sich ganz zentral auf die Fähigkeiten dieses Implementationsakteurs stützen. Die Entscheidung, die Sozial- und Arbeitslosenhilfe kurz vor die politisch als entscheidend angesehenen Wahlen in Nordrhein-Westfalen zu legen, war nur möglich, weil die beteiligten Politiker davon ausgehen konnten, dass die Implementation in der Bundesanstalt für Arbeit technisch und organisatorisch gelingen würde. Diese Annahme beruhte auf Aussagen der Verantwortlichen der Bundesanstalt, die sich später als zu optimistisch erwiesen. Zudem trug der Streit mit der Union über die Optionskommunen zu Verzögerungen gegenüber allerersten Zeitplänen bei.
Bei der Schaffung klarer Verantwortlichkeiten muss zwischen der Ebene der einzelnen Gesetze und dem Gesamtbereich der Agenda 2010 differenziert werden. Die Umsetzung der einzelnen Gesetze erfolgte im Rahmen des Ressortprinzips: Ein Gesetz wird unter der Federführung eines Bundesministeriums erarbeitet, koordiniert und auf den üblichen Wegen der ministeriell-bürokratischen Verantwortlichkeiten implementiert. Damit war sicherlich eine transparente Verteilung von Verantwortlichkeiten gegeben, wenn auch bisher schon die Implementation in dem betreffenden Politikfeld durchschaubar strukturiert war. War dies jedoch nicht der Fall, konnte im Rahmen des Agenda-Prozesses keine höhere Transparenz erreicht werden, da es nicht zur Zentralisierung von Implementationskompetenzen kam.
Eine klare Benennung von Verantwortlichen für den Gesamtbereich der Agenda 2010 war dagegen nicht gegeben. Sieht man die Agenda als Marketingkonzept, ist die Zuständigkeit beim Presseund Informationsamt der Bundesregierung gebündelt, rückgekoppelt über die Zugehörigkeit des Regierungssprechers und Chefs des Bundespresseamts Béla Anda zum informellen Kreis um Schröder. Betrachtet man dagegen die Agenda als inhaltliches Konzept der Abstimmung von Politiken verschiedener Felder aufeinander, sind etliche Ressorts und Spiegelreferate im Bundeskanzleramt gleichermaßen beteiligt. Alle hätten über das übliche Maß hinaus koordiniert oder einer zentralen Steuerungseinheit unterstellt werden müssen. Eine derartige Gesamtkoordinierung dürfte jedoch, selbst wenn sie gewollt worden wäre, bei der Vielzahl der Gesetzesmaterien kaum durch eine zentrale Stelle gelingen.
Die vielen Policy-Felder machten auch den Umgang mit Stakeholdern zu einem Problem. Neben dem puren Mengenaspekt ist bei der näheren Klärung, ob und wie bestimmte Stakeholder einzubeziehen sind, auch wieder zu unterscheiden zwischen dem Marketing- und dem Policy-Aspekt der Agenda-Politik.
In der Marketingperspektive wird durch die Bündelung verschiedener Gesetze unter dem Label Agenda 2010 angekündigt, dass die Regierung hier einen Schwerpunkt setzt, diese Reformen für unverzichtbar hält und sich von ihnen einen besonderen Beitrag zur Verbesserung der Wachstumsbedingungen erhofft. Die Betonung der Notwendigkeit dieser Reformen signalisiert zudem, dass die Regierung keine großen Verhandlungsspielräume im Implementationsgeschehen mehr zulassen will: Sie ist gewillt, Durchsetzungsfähigkeit zu demonstrieren. Somit sind alle im jeweiligen Politikfeld Betroffenen rechtzeitig vorgewarnt, dass es die Regierung besonders ernst meint. In der Marketingperspektive ist das Kriterium einer klaren Ansprache der Stakeholder mithin erfüllt.
Das gilt jedoch nur bedingt in der Policy-Perspektive. Die wechselseitige Wirksamkeit und Verbundenheit aller Reformen ist angesichts der hohen Zahl eingebundener Gesetzesmaterien für die Implementationsakteure nicht absehbar. Somit bleiben die politikfeldspezifischen Bedingungen prägend – und diese mögen von Feld zu Feld differieren.
Für die Arbeitsmarktpolitik kann davon ausgegangen werden, dass die Implikationen der Hartz-Gesetze auch den Beteiligten in der Bundesagentur für Arbeit erst im Zuge der Umsetzung selbst in Gänze deutlich geworden sein dürften. Dies mag auch daran liegen, dass die Auswirkungen der Hartz-Gesetze von neuen IT-Programmen bis zu grundlegenden Organisationsreformen und einer Veränderung der Leistungsinstrumente reichten. In der Arbeitsmarktpolitik war andererseits durch die Ankündigung einer Eins-zu-eins-Umsetzung des Hartz-Kommissionskonzeptes in der Regierungserklärung vom Oktober 2002 der Beteiligungsspielraum für alle Stakeholder zunächst stark eingeengt worden.
Dass selbst bei einer Eins-zu-eins-Umsetzung (zu der es nicht gekommen ist, vgl. Jann und Schmid 2004) noch genügend Implementationsspielraum für relevante Modifikationen oder Ausprägungen auf der Ebene der Details vorhanden gewesen wäre, ist sicherlich richtig. Nur bedeutete die Ankündigung der Eins-zu-eins-Umsetzung eben gerade keine Einladung an die Stakeholder, sich als Beteiligte und Mitwirkende zu verstehen. Die Spielräume im Prozess wurden vielmehr als stark eingeschränkt dargestellt. So waren Verantwortlichkeiten geklärt und Beteiligungsgrade vorab festgelegt, aber in einer nur teils partizipatorischen, überwiegend eher exkludierenden Form.
5.2 Top-down-Implementation – zur Dimension der Kommunikation
Erfolgreiche kommunikative Politikumsetzung ist erreicht, wenn transparente Abläufe gewährleistet sind und durch entsprechende Kommunikationsformen zwischen Politik, Verwaltung und Bürgern Bürgernähe entsteht. Die Herstellung von Transparenz über Implementationsprobleme ist dabei kaum zu trennen vom Umgang mit der Reformkritik, die sich sowohl an den intendierten als auch den nichtintendierten Folgen eines Reformprogramms festmacht. Insbesondere der Umbau der Bundesanstalt zur Bundesagentur für Arbeit und die Einführung des ALG II haben eine Fülle von Umsetzungsschwierigkeiten mit sich gebracht, man denke nur an die organisatorischen Restrukturierungen und die Umstellung der Computerprogramme.
Fragen der verwaltungstechnischen Umsetzung der Hartz-Reformen verknüpften sich in der Kritik jedoch mit Vorbehalten gegenüber deren Zielsetzung. So ist kaum zu entscheiden, ob die Kritik einer Regelung, z. B. jener, Lebensversicherungen in die Bedarfsberechnung von SGB-II-Leistungen einzubeziehen, als Implementations- oder als Programmproblem zu betrachten ist. Durch diese enge Verknüpfung von Entscheidung und Umsetzung in der öffentlichen Kritik war auch die Bereitschaft, Probleme in der Reformumsetzung transparent zu machen, nicht ohne Vorbehalt vorhanden, musste doch immer zugleich das gesamte Vorhaben gerechtfertigt und verteidigt werden (vgl. Schabedoth 2005: 97).
Bei einzelnen Fragen der Arbeitsmarktreformen konnte durch gesetzgeberische Korrekturen (Hartz-IV-Änderungsgesetz vom 19. November 2004) jedoch Lösungsbereitschaft bekundet werden. Allerdings dominierte die kommunikative Absicherung des Gesetzgebungsvorhabens, was ein verringertes Interesse an der Transparenz im Bereich der Implementationsprozesse nach sich zog.
Zudem hatten die Umbaupläne in der Bundesanstalt für Arbeit einen so hohen Komplexitätsgrad, dass eine breite Kommunikation mit den Bürgern nicht mehr herstellbar war. Bereits die Schaffung innerbehördlicher Transparenz und Informiertheit war eine hoch anspruchsvolle Aufgabe.
Außerdem wurde durch die Debatte um die Fragebögen für potenzielle ALG-II-Empfänger jegliche Möglichkeit verspielt, die neue Arbeitsverwaltung als bürgernahe Verwaltung darzustellen. Stattdessen wurde das alte Bild der Auslieferung der ganzen Person an eine übermächtige Bürokratie weiter befördert. Reformen in der Bundesagentur für Arbeit wurden zudem nicht im Zusammenspiel mit den Klienten erprobt und unter ihrer Einbeziehung umgesetzt. Die Topdown-Perspektive dominierte allein schon deshalb, weil die Sicherung des Zusammenspiels zwischen Kommunen, Bundesagentur für Arbeit, Bund und Ländern ein derart aufwändiges Unterfangen war, dass eine bürgernahe Implementationspolitik nur als weiterer Stör- und Konfliktfaktor erscheinen konnte.
5.3 Policy-Wirkungen und politischer Erfolg – zur Dimension der Kompetenz
Im Rahmen der Agenda-Politik gab es kaum Leitlinien, die die Wirkungsorientierung in der Umsetzungsphase hätten sicherstellen können. Dies liegt auch daran, dass die Wirkungsorientierung zwar im Policy-Kontext ein unverzichtbares Rationalitätskriterium darstellt – die jüngere Literatur zum Verwaltungshandeln im Rahmen des New Public Management verlangt genau diese Festlegung auf messbare Leistungsziele (Output und vor allem Outcome) –, aus Politics-Gründen jedoch als problematisch angesehen werden kann.
So gab Peter Hartz als Zielsetzung eine bestimmte Höhe der Arbeitslosigkeit an – ganz in der Tradition der Arbeitslosenzieldefinition von Kanzler Gerhard Schröder nach seinem Wahlsieg 1998. Anfang 2005 stieg die Zahl der Arbeitslosen dann auf über fünf Millionen. Grund dafür waren auch statistische Effekte, denn durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wurden erwerbsfähige bisherige Sozialhilfeempfänger in der Arbeitslosenstatistik aufgeführt. In Anbetracht dessen kann man eine Nennung von quantifizierten Wirkungszielen geradezu als strategischen Fehler ansehen.
In der Programmatik der Agenda 2010 wurde infolgedessen auf eine nochmalige Nennung von konkreten Niveaus der Arbeitslosigkeit bewusst verzichtet. Es finden sich kaum mehr klar definierte Wirkungen, deren Erreichen als Anzeichen des Erfolgs der Regierungspolitik gelten könnte. Zwar lagen für die einzelnen Policys durchaus Ziele, auch quantitativer Art, vor – z. B. wurden Beitragssatzzielsetzungen genannt –, doch ein Pendant auf der Ebene des Gesamtreformpakets fehlte.
Die ältere Forderung nach einer Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge auf insgesamt nicht mehr als 40 Prozent kann vielleicht als ein solches übergreifendes Ziel gewertet werden, ebenso wirtschaftliche Wachstumsraten. Damit würden jedoch die Wirkungsziele eines Reformpaketes mit den Zielsetzungen der Bundesregierung gemäß Jahreswirtschaftsbericht weitgehend zusammenfallen. Für breit angelegte Reformpakete muss man jedoch zusätzliche Wirkungsziele auch auf der Ebene der im weiteren Sinne politischen Auswirkungen erwarten. Eine derartige Vorgabe von politischen Zielen für die Umsetzungsphase fehlte.
Die Maßnahmenplanung und Festlegung der Umsetzungsschritte erfolgte entsprechend weitgehend entpolitisiert. Sie folgte verwaltungsorganisatorischen Überlegungen. Auf der Ebene der Arbeitsmarktpolitik erforderte die Umsetzung dabei in hohem Ausmaß die Einschaltung von Unternehmensberatungen.
Auch die genaue Ausrichtung und das Einsetzen geeigneter Steuerungsinstrumente verlangte vor allem konkretisierende Arbeiten auf der Ebene der Bundesagentur für Arbeit. Zum Zeitpunkt der Regierungserklärung waren jedoch etliche Maßnahmenplanungen und die Auswahl geeigneter Steuerungsinstrumente bereits erfolgt. Die Rede selbst ist ein Maßnahmenkatalog mit zum Teil recht konkreten Ausführungen zu einzelnen Elementen.
Die Implementation der Agenda 2010 als Reformpaket bezieht sich daher eher auf die Absicherung der politischen Durchsetzung aller Reformmaßnahmen. Hier ist es 2004 vor allem durch die Forderung der Union nach einer führenden organisatorischen Rolle der Kommunen beim neuen ALG II und durch den Druck in Richtung einer Ausbildungsabgabe zu Schwierigkeiten gekommen, die erneute Überlegungen auf der Ebene der Instrumente erforderten.
Nachträglich kann die Einbringung eines Gesetzentwurfes zur Einführung einer Ausbildungsabgabe als Versuch der Druckerhöhung auf die Arbeitgeber gewertet werden, damit diese das eigentlich (und von Schröder immer explizit) gewünschte Instrument der freiwilligen Selbstverpflichtung akzeptierten. Diese Rückkehr auf die Ebene der Instrumentenwahl in der Umsetzungsphase war unbeabsichtigt, folgte den in diesem Maße wohl nicht erwarteten Konflikten um die Agenda 2010 und blieb damit wesentlich reaktiv.
6 Erfolgskontrolle
6.1 Umschalten und Umsteuern – zur Dimension der Durchsetzungsfähigkeit
Kernelement einer begleitenden Erfolgskontrolle muss die Ermöglichung eines flexiblen Nachsteuerns bei Beachtung veränderter Akteurskonstellationen sein. Reformanpassungen waren im AgendaProzess aufgrund der Zustimmungspflichtigkeit der meisten Agenda-Gesetze und der Stärke der CDU/CSU im Bundesrat erforderlich.
Die dramatischen Einigungsprozesse im Vermittlungsausschuss im Dezember 2002 und 2003, aber auch im Juli 2004, führten zu einer Reformgestaltung, in die Ansätze von Regierung und Opposition eingingen. Die öffentliche Verantwortlichkeit für die jeweils endgültige Reform lag jedoch praktisch allein bei der Regierung. Die Opposition ließ sich nicht in die Mitverantwortung einbinden. Im weiteren Verlauf stand aufgrund der erheblichen Widerstände seitens der Gewerkschaften und der geringen Akzeptanz in Teilen der Bevölkerung die machtgestützte Durchsetzung der Reformen im Vordergrund. Öffentliche Skandalisierungen wie die bereits erwähnte Einbeziehung von Lebensversicherungen und anderen Formen der Altersvorsorge in die Bedürftigkeitsprüfungen zum Bezug von ALG II bildeten durchaus eine Gefahr für die gesamte Reform.
Das Umschalten auf eine durchsetzungsorientierte Politik beinhaltete auch den Verzicht darauf, sich die Möglichkeit zu frühzeitigem Gegensteuern offenzuhalten. Durch den öffentlich bekundeten Verzicht auf ein abermaliges Umsteuern auch und gerade angesichts der eklatanten Widerstände in Partei, Fraktion und in der nicht-medialen Öffentlichkeit und auch angesichts der Schwierigkeiten einer Erfolg versprechenden Umsetzung innerhalb der politisch relevanten Zeiträume sollte die Durchsetzung dauerhaft gesichert, die Gruppe der (potenziellen) Reformgegner entmutigt und geschwächt werden. Eine Haltung der Offenheit für Umsteuerungen war mit dieser machtzentrierten Durchsetzungspolitik nicht zu vereinbaren. So war die Mischung von Kritikabwehr bzw. Verteidigung des Reformansatzes (trotz der offenbar inkonsistenten Beziehung zwischen der ALGII-Einführung und den Überlegungen der Altersvorsorgereform von 2001) und inkrementeller Reformanpassung bestimmend.
Jedoch muss unterstellt werden, dass aus dem Akzeptanzmangel der Agenda-2010-Politik auch eine Reduktion der Handlungsspielräume für Reformanpassungen folgte, wodurch Politiklernen in einem offenen, Argumenten zugänglichen Sinne überlagert wurde durch die permanenten Anstrengungen, das Reformkonzept überhaupt durchzuhalten. Lernfähigkeit verlangt Reflexionsfähigkeit. Reflexion meint jedoch die Möglichkeit der hypothetischen Infragestellung, um Folgen unterschiedlicher Maßnahmen, Reformen überhaupt erörtern zu können. Wenn eine – sei es auch nur denkexperimentelle – Infragestellung sogleich als politische Positionierung, als Stellungnahme gedeutet wird, kann es freies Nachdenken nicht mehr geben. Es war ein hoher Machteinsatz erforderlich, um die eigenen Leute auf Kurs zu halten und die Reform zu bewahren.
Dabei hätte es aufgrund der technischen und inhaltlichen Komplexität des Reformwerks enorm viele Anlässe für Lernschritte gegeben. In kleinerem Umfang und auf der mehr technischen Ebene wurden diese auch genutzt. Jedoch mündete die Gefahr der öffentlichen Thematisierung und damit Politisierung in eine stark begrenzte Bereitschaft, zu lernen und Instrumente anzupassen, und erhöhte wiederum nicht die Möglichkeit, zusätzliche Legitimation durch politische Lernbereitschaft zu schaffen.
Der ursprüngliche Mangel an Akzeptanz führte auf der Ebene der Erfolgskontrolle und Nachsteuerung nur zu einer weiteren Steigerung des Legitimationsdefizits. So kam eine Art von Teufelskreis in Gang, der darauf beruhte, dass die stark angegriffene Reform ihre Durchsetzung bei möglichst wenigen Änderungen beweisen musste, mithin jede Anregung zum Lernen und Anpassen als potenzielle Bedrohung des Reformkerns erschien.
Ein entspanntes Umgehen mit Kritik und Änderungsideen wird unter diesen Bedingungen nicht zugelassen. Es bildet sich eher eine Festungsmentalität der Reformbetreiber heraus, die in der medialen Öffentlichkeit wiederum abschreckend wirken kann. Politische Lernbereitschaft weicht der permanenten Abwehrbereitschaft, der durchaus aggressiv vorgetragenen Verteidigung der Reform, mithin einer Defensivhaltung, die eher dem »Mauern« verbunden ist als einer flexiblen Reaktion auf gegnerische Angriffe.
6.2 Reformkontrolle – zu den Dimensionen Kommunikation und Kompetenz
Die öffentliche Resonanz zu den Reformvorhaben und den Reformergebnissen wurde fortwährend erhoben. Die Regierung verfolgte das Vorhaben der Agenda 2010 jedoch unabhängig von der demoskopischen Lage und der öffentlichen Meinung der Bürger. Eher ungünstige Umfrageergebnisse führten lediglich zur Entwicklung einer Werbekampagne zugunsten der Agenda 2010, die in den Printmedien mit hohem Finanzeinsatz unter Einschaltung externer Agenturen betrieben wurde.
Ein Dialog mit zentralen Reformbetroffenen war angesichts der Ausgangslage und der Konzeption der Agenda 2010 als Konfliktformel nicht beabsichtigt. Der Dialog – im Rahmen des Bündnisses für Arbeit – galt als gescheitert. Da die Gewerkschaften im Frühsommer 2003 zudem mit großem Aufwand, jedoch mit wenig Resonanz, gegen die Agenda mobilisierten, war auch seitens dieses Stakeholders keine Dialogbereitschaft vorhanden.
Gegenüber den breiter aufgestellten (da nicht nur vom DGB getragenen) Protesten im Sommer 2004 zeigte die Bundesregierung wenig Bereitschaft, den Dialog mit den Protestierenden zu suchen. Das Reformprogramm befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Phase, die auf Durch- und Umsetzung ausgerichtet war. Ein Dialog hätte wie ein Eingeständnis der Unsicherheit über die Qualität des eigenen Reformansatzes gewirkt. Das Auftreten der NPD und andererseits die starke Rolle der PDS bei den Montagsdemonstrationen konnte genutzt werden, um den Protest nicht ernst zu nehmen bzw. sich von ihm deutlich zu distanzieren.
Begleitende Evaluationen gab es für einzelne der Reformvorhaben, so insbesondere bei den Hartz-Reformen, die einem besonders hohen Grad wissenschaftlicher Evaluation (vgl. BMAS 2006; zusammenfassend auch Oschmiansky, Mauer und Schulze Buschoff 2007) und begleitender Beobachtung (Hartz-Ombudsrat) unterzogen wurden. Eine Evaluation des Gesamtprozesses der Agenda 2010 fehlte dagegen, sodass deren Wirkungsqualität insgesamt sowie die Gesamtkosten des Reformpakets nicht kontrolliert und transparent gemacht wurden (die Kostenbilanz von Hartz IV ist zudem auffallend ungünstig, vgl. Egle und Zohlnhöfer 2007: 515), während die Zeitplanung durchaus laufender Kontrolle und Nachsteuerung unterlag.
Bis heute ist eine retrospektive Bewertung der Erreichung des Leitziels und der Nebenwirkungen innerhalb der SPD nicht möglich (Beschädigung des Ex-Kanzlers, Unterminierung der derzeitigen Regierungspolitik, Aufbrechen alter und neuer Wunden) und von der aktuellen Regierung nicht auf den Weg gebracht.
7 Schluss
Will man die vorliegende Bewertung der strategischen Qualität des Agenda-2010-Prozesses in den Dimensionen der Durchsetzungsfähigkeit, Kommunikation und Kompetenz zusammenfassen, lassen sich drei Ergebnisse herausheben:
1. Der Reformprozess besitzt, gemessen an den verwendeten Kriterien, keinen besonders hohen Grad an strategischer Durchformung. Weder wurden die institutionellen Voraussetzungen durch die Ausbildung eines strategiefähigen Machtzentrums mit entsprechendem Unterbau geschaffen noch die Instrumente eingesetzt, die einen strategisch kontrollierten Prozess der Regierungspolitik ermöglicht hätten.
2. Das wesentliche Reformversagen erfolgte in der kommunikativen Dimension. Gerade dort, wo die Stärken des Bundeskanzlers und seiner Politik zu liegen schienen, in der kommunikativen Ansprache der Bürger und Bürgerinnen, kam es zum größten Einbruch: Weder gelang der Aufbau von Vertrauen noch die Herstellung von Bürgernähe, schließlich wurde die Reformbereitschaft nicht gefördert, sondern verringert.
3. Das vorhandene strategische Handeln war nicht auf die eigene Partei, die Regierung als Koalitionsregierung oder eine soziale Gruppe ausgerichtet. Als Bezugspunkt strategischen Denkens und Handelns im Machtzentrum lassen sich plausibel nur eine innerparteiliche Strömung in der SPD oder die Person des Bundeskanzlers selbst unterstellen. Die Entwicklung der Agenda 2010 verweist vielleicht darauf, dass dies ein zu enger Bezugshorizont strategiegeleiteter Politik ist.
Behandelte Themen
Downloads der Fallstudie
- Althaus, Marcus. »Strategien für Kampagnen. Klassische Lektionen und modernes Targeting«. Kampagne! Neue Strategien für Wahlkampf, PR und Lobbying. Hrsg. Marcus Althaus. Münster, Hamburg und London 2002. 11 – 44.
- Baring, Arnulf, und Gregor Schöllgen. Kanzler, Krisen, Koalitionen. Von Konrad Adenauer bis Angela Merkel. Aktualisierte und erweiterte Ausgabe. München 2006.
- Blancke, Susanne, und Josef Schmid. »Bilanz der Bundesregierung Schröder in der Arbeitsmarktpolitik 1998 – 2002: Ansätze zu einer doppelten Wende«. Das rot-grüne Projekt. Eine Bilanz der Regierung Schröder 1998 – 2002. Hrsg. Christoph Egle, Tobias Ostheim und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2003. 213 – 238.
- Bönker, Frank. »Interdependenzen zwischen Politikfeldern – die vernachlässigte sektorale Dimension der Politikverflechtung«. Die Zukunft der Policy-Forschung. Theorien, Methoden, Anwendungen. Hrsg. Frank Janning und Katrin Toens. Wiesbaden 2008. 315 – 330.
- Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMAS). Die Wirksamkeit moderner Dienstleistungen am Arbeitsmarkt – Bericht 2006 des BMAS zur Wirkung der Umsetzung der Vorschläge der Kommission Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Berlin 2006.
- Dettling, Warnfried. »Strategiebildung und Strategieblockaden: Ein Resümee«. Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen (18) 2 2005. 90 – 97.
- Egle, Christoph. »Deutschland«. Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa. Hrsg. Wolfgang Merkel et al. Wiesbaden 2006. 154 – 196.
- Egle, Christoph, und Reimut Zohlnhöfer. »Projekt oder Episode – was bleibt von Rot-Grün?« Das rot-grüne Projekt. Eine Bilanz der Regierung Schröder 1998 – 2002. Hrsg. Christoph Egle, Tobias Ostheim und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2003. 511 – 535.
- Egle, Christoph, und Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.). Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002 – 2005. Wiesbaden 2007.
- Egle, Christoph, Tobias Ostheim und Reimut Zohlnhöfer (Hrsg.). Das rot-grüne Projekt. Eine Bilanz der Regierung Schröder 1998 – 2002. Wiesbaden 2003.
- Fischer, Joschka. Die rot-grünen Jahre. Deutsche Außenpolitik – vom Kosovo bis zum 11. September. Köln 2007.
- Fischer, Thomas, Gregor Peter Schmitz und Michael Seberich (Hrsg.). Die Strategie der Politik. Ergebnisse einer vergleichenden Studie. Gütersloh 2007.
- Geyer, Matthias, Dirk Kurbjuweit und Cordt Schnibben. Operation Rot-Grün. Geschichte eines politischen Abenteuers. München 2005.
- Grasselt, Nico, und Karl-Rudolf Korte. Führung in Politik und Wirtschaft. Instrumente, Stile und Techniken. Wiesbaden 2007.
- Haubner, Dominik. »Einige Überlegungen zum Zusammenspiel zwischen Umsetzung und Kommunikation arbeitsmarktpolitischer Reformen«. Agendasetting und Reformpolitik. Strategische Kommunikation zwischen verschiedenen politischen Welten. Hrsg. Dominik Haubner, Erika Mezger und Hermann Schwengel. Marburg 2005. 311 – 341.
- Haubner, Dominik, Erika Mezger und Hermann Schwengel (Hrsg.). Agendasetting und Reformpolitik. Strategische Kommunikation zwischen verschiedenen politischen Welten. Marburg 2005.
- Jann, Werner, und Günther Schmid (Hrsg.) Eins zu Eins? Eine Zwischenbilanz der Hartz-Reformen am Arbeitsmarkt. Berlin 2004.
- Kamps, Klaus. Politisches Kommunikationsmanagement. Grundlagen und Professionalisierung moderner Politikvermittlung. Wiesbaden 2007.
- Kamps, Klaus, und Jörg-Uwe Nieland (Hrsg.). Regieren und Kommunikation. Meinungsbildung, Entscheidungsfindung und gouvernementales Kommunikationsmanagement – Trends, Vergleiche, Perspektiven. Köln 2006.
- Kornelius, Bernhard, und Dieter Roth. »Bundestagswahl 2005: RotGrün abgewählt. Verlierer bilden die Regierung«. Ende des rotgrünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002 – 2005. Hrsg. Christoph Egle und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2007. 29 – 59.
- Korte, Karl-Rudolf. »Der Pragmatiker des Augenblicks: Das Politikmanagement von Bundeskanzler Gerhard Schröder 2002 – 2005«. Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002 – 2005. Hrsg. Christoph Egle und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2007. 168 – 196.
- Korte, Karl-Rudolf, und Manuel Fröhlich. Politik und Regieren in Deutschland. Strukturen, Prozesse, Entscheidungen. Paderborn u. a. 2004.
- Machnig, Matthias. »Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft«. Politik – Medien – Wähler. Wahlkampf im Medienzeitalter. Hrsg. Matthias Machnig. Opladen 2002. 145 – 152.
- Machnig, Matthias. »Wege und Strategien erfolgreicher Reformkommunikation in der modernen Demokratie«. Manuskript 2007.
- Merkel, Wolfgang, et al. Die Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der Regierungspolitik in Westeuropa. Wiesbaden 2006.
- Meyer, Thomas. »Die blockierte Partei – Regierungspraxis und Programmdiskussion der SPD 2002 – 2005«. Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002 – 2005. Hrsg. Christoph Egle und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2007. 83 – 97.
- Nullmeier, Frank, und Thomas Saretzki (Hrsg.). Jenseits des Regierungsalltags. Strategiefähigkeit politischer Parteien. Frankfurt am Main und New York 2002.
- Oschmiansky, Frank, Andreas Mauer und Karin Schulze Buschoff. »Arbeitsmarktreformen in Deutschland – Zwischen Pfadabhängigkeit und Paradigmenwechsel«. WSI-Mitteilungen (60) 6 2007. 291 – 297.
- Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.). »Antworten zur agenda 2010«. Berlin 2003.
- Raschke, Joachim. »Politische Strategie. Überlegungen zu einem politischen und politologischen Konzept«. Jenseits des Regierungsalltags. Strategiefähigkeit politischer Parteien. Hrsg. Frank Nullmeier und Thomas Saretzki. Frankfurt am Main und New York 2002. 207 – 241.
- Raschke, Joachim, und Ralf Tils. Politische Strategie. Eine Grundlegung. Wiesbaden 2007.
- Schabedoth, Hans-Joachim. »Zwei vor, drei zurück. Über die Sprunghaftigkeit politischer Zielplanungen im Geflecht von Regierungs- und Gewerkschaftspolitik«. Agendasetting und Reformpolitik. Strategische Kommunikation zwischen verschiedenen politischen Welten. Hrsg. Dominik Haubner, Erika Mezger und Hermann Schwengel. Marburg 2005. 87 – 106.
- Schmid, Josef. »Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik – große Reform mit kleiner Wirkung?«. Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002 – 2005. Hrsg. Christoph Egle und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2007. 295 – 312.
- Schröder, Gerhard. Entscheidungen. Mein Leben in der Politik. Aktualisierte und erweiterte Ausgabe. Berlin 2007.
- Schröder, Gerhard, und Tony Blair. »Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten«. Blätter für deutsche und internationale Politik (44) 7 1999. 887 – 896.
- Schröder, Peter. Politische Strategien. Baden-Baden 2000. Speth, Rudolf. »Strategiebildung in der Politik«. Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen (18) 2 2005. 20 – 37.
- Tils, Ralf. Politische Strategieanalyse. Konzeptionelle Grundlagen und Anwendung in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik. Wiesbaden 2005.
- Weßels, Bernhard. »Organisierte Interessen und Rot-Grün: Temporäre Beziehungsschwäche oder zunehmende Entkoppelung zwischen Verbänden und Parteien«. Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002 – 2005. Hrsg. Christoph Egle und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2007. 151 – 167.
- Zohlnhöfer, Reimut, und Christoph Egle. »Der Episode zweiter Teil – ein Überblick über die 15. Legislaturperiode«. Ende des rotgrünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002 – 2005. Hrsg. Christoph Egle und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2007. 11 – 25.